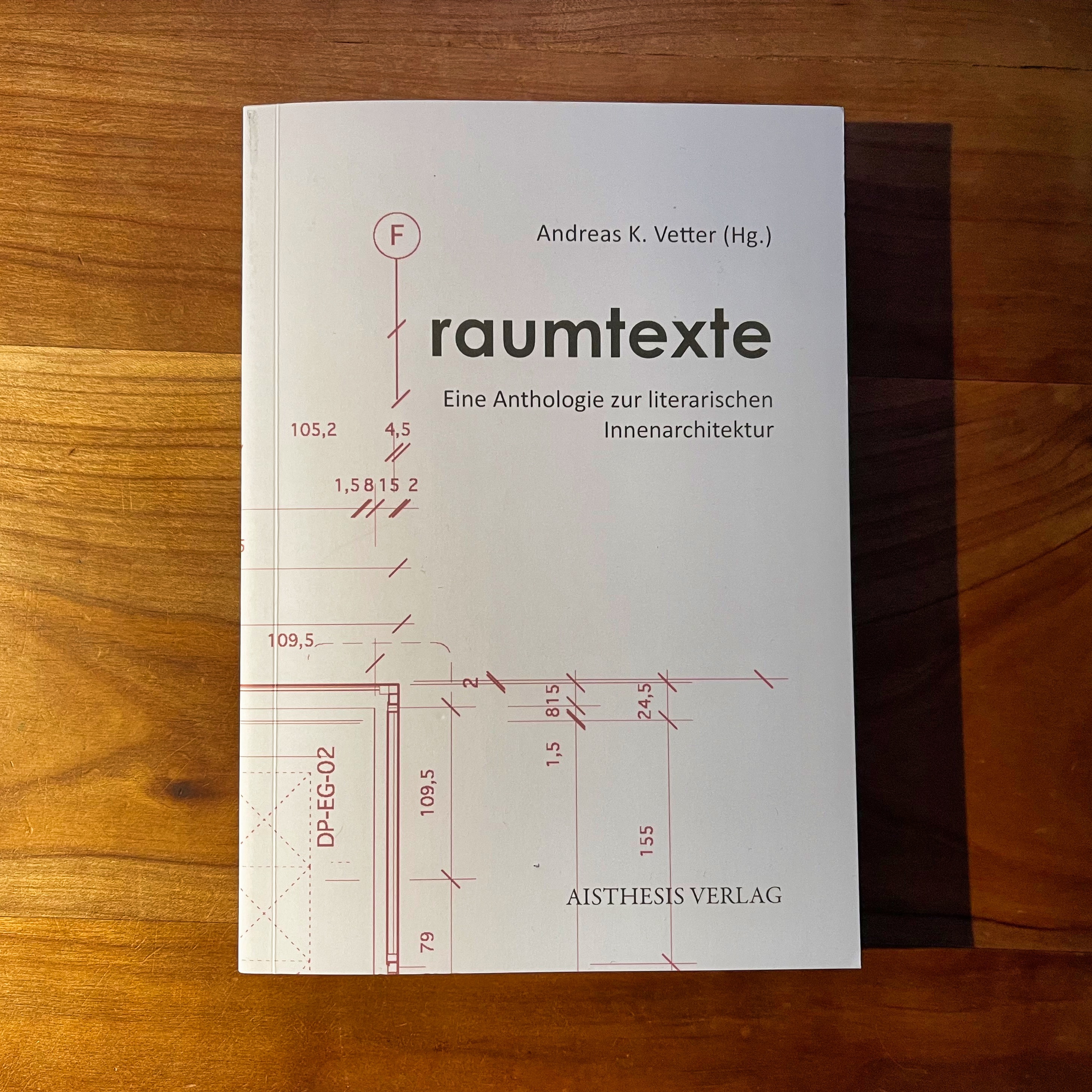Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch – Einleitung in die philosophische Anthropologie
Theorie„Die Stufen des Organischen und der Mensch – Einleitung in die philosophische Anthropologie“ von Helmuth Plessner ist 1975 in 3., unveränderter Auflage beim Verlag Walter de Gruyter Berlin und New York erschienen.
Wie der Untertitel deutlich macht, handelt es sich um einen Beitrag zur philosophischen Anthropologie. Helmuth Plessner ist einer der bedeutendsten Vertreter dieser Disziplin in Deutschland. In sieben Kapiteln entwickelt Plessner ausgehend von Descartes und der deutsch-französischen Lebensphilosophie (Dilthey, Spengler, Bergson) eine Analyse des Lebendigen, die in einer Analyse des menschlichen Daseins gipfelt. Wir beschränken uns im Folgenden auf das siebte Kapitel, „Die Sphäre des Menschen“, den Kern seiner Anthropologie.
Den Menschen beschreibt Plessner zunächst in Abgrenzung zum Tier. Er ist im Gegensatz zum Tier nicht ständig im Hier und Jetzt, sondern er ist darüber hinaus. Aus diesem Über-sich-hinweg, gelangt der Mensch als einziges (bekanntes) Lebewesen in einen Bezug zu sich selbst. Er lebt in einer doppelten „Distanz“, zu den Dingen und zu sich selbst. In diesem Sinne, ist der Mensch „selbstreflexiv“. Er ist aus seiner Mitte heraus, über sich hinweg. Diese Über-sich-hinweg-Sein eröffnet einen Raum der Entscheidungen und damit der Freiheit.
„Ist das Leben des Tieres zentrisch, so ist das Leben des Menschen, ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich aus ihr heraus, exzentrisch. Exzentrizität ist die für den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit gegen das Umfeld.“ (Seite 291f)
Dieses Umfeld als Spielraum des Über-sich-hinweg bezeichnet Plessner als Welt. Diese wiederum gliedert er in drei Bereiche: Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt. Die Außenwelt ist dabei die Welt der Dinge im weitesten Sinne, die „Natur“. Bezogen auf die Außenwelt kann der Mensch nach Plessner unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: als Körper (Ding unter Dingen) und als Leib (Selbstwahrnehmung).
„Deshalb sind beide Weltansichten notwendig, der Mensch als Leib in der Mitte einer Sphäre, die entsprechend seiner empirischen Gestalt ein absolutes Oben, Unten, Vorne, Hinten, Rechts, Links, Früher und Später kennt, eine Ansicht, die als Basis der organologischen Weltanschauung dient, und der Mensch als Körperding an einer beliebigen Stelle eines richtungsrelativen Kontinuums möglicher Vorgänge, eine Ansicht die zur mathematisch-physikalischen Auffassung führt.“ (Seite 294)
Von dieser „Außenwelt“, der Welt der Dinge, der Natur etc., unterscheidet Plessner die „Innenwelt“. „In der Distanz zu ihm selber ist sich das Lebewesen als Innenwelt gegeben. Das Innen versteht sich im Gegensatz zum Außen des vom Leib abgehobenen Umfeldes.“ (Seite 295) Ein wesentlicher Unterschied besteht für Plessner darin, dass sich die Innenwelt in zahllose Möglichkeiten an Graden der Wirklichkeit ausdifferenziert. Die Innenwelt kennt mehr oder weniger starke Intensitäten des Seins – eine „Skala des Seins“. Es gibt verschieden intensive Grade der seelischen Wirklichkeit. Plessner beschreibt dies mit den Begriffen Hingenommenheit, Selbstvergessenheit, verdrängte Erlebnisse, Anmutungen. Diese können alle mehr oder weniger intensiv gegeben sein. Kurz: Plessner meint mit Innenwelt, das, was wir allgemein der Psychologie zuordnen.
Nun befinden wir uns nicht allein in einem Gegensatz von Innenwelt (Seele) und Außenwelt (Natur), sondern wir bewegen uns „gemeinsam“ in dieser Außenwelt. „Der Mensch sagt zu sich und anderen Du, Er, Wir –, nicht etwa darum, weil er erst auf Grund von Analogieschlüssen oder einfühlenden Akten in Wesen, die ihm am konformsten erscheinen, Personen annehmen müsste, sondern kraft der Struktur der eigenen Daseinsweise.“ (Seite 300) Die Mitwelt ist die immer schon vorweg gegebene Welt des anderen Lebendigen. Sie erstreckt sich auf unsere Mitmenschen, bisweilen auch auf Tiere und Pflanzen und in extremis auch auf „beseelte“ Gegenstände. In der Mitwelt erleben wir uns in der Differenz zu anderem Lebendigen. Gleichzeitig erfahren wir (meistens unthematisch) die Mitwelt als Voraussetzung unseres Seins, z.B. als Sprache oder Kultur. „Die Mitwelt trägt die Person, indem sie zugleich von ihr getragen und gebildet wird. Zwischen mir und mir, mir und ihm liegt die Sphäre dieser Welt des Geistes.“ (Seite 303) Plessner unterscheidet also den Geist von der Seele. Und es ist letzten Endes diese Unterscheidung, die den Menschen als Teil eines Miteinander ausmacht.
„Die Sphäre, in der wahrhaft Du und Ich zur Einheit des Lebens verknüpft sind und einer dem anderen in’s aufgedeckte Antlitz blickt, ist aber dem Menschen vorbehalten, die Mitwelt, in der nicht nur Mitverhältnisse herrschen, sondern das Mitverhältnis zur Konstitutionsform einer wirklichen Welt des ausdrücklichen Ich und Du verschmelzenden Wir geworden ist.“ (Seite 308)
Schlussendlich lässt sich der Begriff der Außenwelt dem Begriff des Körpers, der Begriff der Innenwelt den Begriffen Leib und Seele und schließlich der Begriff der Mitwelt dem Begriff des Geistes zuordnen. Wobei klar ist, dass keiner der damit bezeichneten Sachverhalte für sich besteht und sie alle Gemeinsam das Spannungsverhältnis von Mensch und Welt ausmachen.
Aus dieser grundlegenden Verfassung des Menschen leitet Plessner im Folgenden drei anthropologische Grundgesetze ab. Das ist „I. Das Gesetz der der natürlichen Künstlichkeit“. Das besagt, es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich selbst in Frage stellt und dadurch einen Bezug zu den eigenen Möglichkeiten erlangt.
„Und die Frage der Philosophie wie im Grunde jede Frage, die der Mensch sich tausendmal im Lauf seines Lebens vorzulegen hat: was soll ich tun, wie soll ich leben, wie komme ich mit dieser Existenz zu Rande –, bedeutet den […] wesenstypischen Ausdruck der Gebrochenheit oder Exzentrizität, der keine noch so naive, naturnahe, ungebrochene, daseinsfrohe und traditionsgebundene Epoche der Menschheit sich entwinden konnte.“ (Seite 309)
Das Leben ist ein permanenter Vollzug, immer unterwegs. Auf eine gewisse Weise liegt der Mensch in seinem Lebensvollzug dabei „quer“ zur Natur, seine eigene miteingeschlossen. Dadurch, dass er auf bestimmte Weise außerhalb und gegen die Natur steht, hält er sich durch sein eigenes Schaffen in der Natur, indem er diese ergänzt. Man könne sagen, wir bringen als Menschen die Welt zu einer neuen Ganzheit. Die „exzentrische Lebensform“ des Menschen ist auf ihre Art „ergänzungsbedürftig“.
Plessner stößt hier auf den Gegensatz von Kultur und Natur und wendet sich dabei einerseits gegen Darwin, Gehlen und Freud, die den Menschen als Mängelwesen beschreiben. Kultur ist aus dieser Perspektive eine Kompensation dieser Mangelhaftigkeit. Andererseits wendet er sich auch gegen Schopenhauer, Nietzsche und Adler, die Kultur als ein Produkt der Überfülle des menschlichen Potenzials (etwa Wille zur Macht) verstehen. Für Plessner ist die Kultur beides zugleich, Antwort auf einen Mangel und ein Produkt der Überfülle des Über-sich-hinweg des Menschen.
„Existentiell bedürftig, hälftenhaft, nackt ist dem Menschen die Künstlichkeit wesensentsprechender Ausdruck seiner Natur. Sie ist der mit der Exzentrizität gesetzte Umweg zu einem zweiten Vaterland, in dem er Heimat und absolute Verwurzelung findet. Ortlos, zeitlos, ins Nichts gestellt schafft sich die exzentrische Lebensform ihren Boden.“ (Seite 316)
Aus der Natur herausgefallen sucht der Mensch immer wieder nach seinem Gleichgewicht und nach seinem Stand in der Natur. „Nur weil der Mensch von Natur halb ist und […] über sich steht, bildet Künstlichkeit das Mittel, mit sich und der Welt ins Gleichgewicht zu kommen.“ (Seite 321) So gesehen ist der Mensch von Natur aus künstlich und künstlerisch, je nachdem, wie man es betrachtet.
Das zweite Gesetz ist „Das Gesetz der vermittelten Unmittelbarkeit – Immanenz und Expressivität“. In jeder kulturellen Schöpfung (Werkzeug, Kunstwerk, ganz allgemein Setzung) liegt ein Moment der Entdeckung. Diese Entdeckung oder Erfindung geschieht unabhängig vom konkreten erschaffenen Gegenstand und bleibt auch über diesen hinaus unabhängig bestehen. Damit bleibt die Entdeckung bis auf Weiteres auch unabhängig vom einzelnen Menschen bestehen. Erfindungen sind nicht Erfindungen des Einzelnen, sondern gehen in die Welt ein.
„Das Geheimnis des Schöpfertums, des Einfalls besteht in dem glücklichen Griff, in der Begegnung zwischen dem Menschen und den Dingen. Nicht das Suchen nach etwas Bestimmtem ist das Prius der eigentlichen Erfindung, denn wer nach etwas sucht, hat in Wahrheit schon gefunden.“ (Seite 322)
Das Erfinden ist ein Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Wobei jede Erfindung oder Entdeckung selbst wiederum den Bereich des Möglichen erweitert.
„Der Mensch lebt in einem Umfeld von Weltcharakter. Dinge sind ihm gegenständlich gegeben, wirkliche Dinge, die in ihrer Gegebenheit von ihrer Gegebenheit ablösbar erscheinen. Zu ihrem Wesen gehört das Überschußmoment des Eigengewichts, des Für sich Bestehens, des An sich Seins, sonst spricht man eben nicht von wirklichen Dingen.“ (Seite 327)
Die Erscheinung der Dinge ist niemals vollständig. Teile der Dinge, Teile ihrer Möglichkeiten bleiben im Verborgenen, sind auf der „abgewandten“ Seite. Dabei ist sie Erscheinung weniger Maske als vielmehr Gesicht der Dinge. Sie enthüllt, indem sie verhüllt. Die Dinge erscheinen aus ihrem Kontextheraus „als vermittelte [Erscheinung] Unmittelbarkeit.“ (Seite 239) Plessner ist hier dem phänomenalen Sachverhalt auf der Spur, den Husserl unter dem Titel „Abschattung“ verhandelt. Die Dinge zeigen uns immer ein Gesicht, ihre materielle „Substanz“ verschließt sich dagegen und entzieht sich dadurch. Niemals dringen wir tatsächlich ins Innere der materiellen Gegebenheit der Dinge ein. Trotzdem sind sie uns unmittelbar gegeben.
„Gerade weil das Subjekt in sich selber steckt und in seinem Bewußtsein gefangen ist, also in doppelter Abhebung von seinen leiblichen Sinnesflächen steht, hält es die von der Realität als Realität, die sich offenbaren soll, geforderte Distanz inne, die seinsentsprechende Distanz, den Spielraum, in welchem allein Wirklichkeit zur Erscheinung kommen kann.“ (Seite 331)
Für Plessner ist dieser Spielraum immer durch ein „Medium“ erfüllt. Dieses Medium bricht auch den aktiven Zugang des „Subjekts“ zu den Dingen, wie das Wasser die Sehstrahlen bricht und demnach eine optische „Täuschung“ erzeugt. Daraus folgt, dass der kreative Zugang des Menschen zu seiner Umwelt immer durch eine nicht vorausberechenbare Brechung abgelenkt wird. Damit wohnt jedem schöpferischen Umgang mit der Welt ein Moment des Zufalls inne, dass über Gelingen und Misslingen von Werken wesentlich mitentscheidet.
Das dritte Gesetz ist „Das Gesetz des utopischen Standortes – Nichtigkeit und Transzendenz“.
Plessner leitet diesen letzten Abschnitt mit einem Archimedes zugeschriebenen Zitat ein: Gebt mir einen Hebelpunkt… „Dieses Wort steht über der ganzen menschlichen Existenz. Ihre exzentrische Form treibt den Menschen zur Kultivierung, sie weckt Bedürfnisse, welche nur durch ein System künstlicher Objekte befriedigt werden können, und zugleich prägt sie ihnen den Stempel der Vergänglichkeit auf. Die Menschen erreichen zu jeder Zeit, was sie wollen. Und indem sie es erreichen, ist schon der unsichtbare Mensch in ihnen über sie hinweggeschritten.“ (Seite 341) In seiner Exzentrizität, in der er immer über sich hinweg ist, kommt der Mensch bei Plessner nirgends wirklich zum Stehen. Er ist qua Existenz ein ständiges Über-sich-hinaus. Seine Standpunkte haben stets nur den Status des Vorläufigen. In diesem Umstand liegt für Plessner der Ursprung der Religion begründet. „Das, was dem Menschen Natur und Geist nicht geben können, das Letzte: so ist es –, will sie [die Religion] ihm geben. Letzte Bindung und Einordnung, den Ort seines Lebens und seines Todes, Geborgenheit, Versöhnung mit dem Schicksal, Deutung der Wirklichkeit, Heimat schenkt nur die Religion.“ (Seite 342) Diese Auflösung im Transzendenten ist aber nur über die Preisgabe des Geistes und der Kultur zu haben. „Wer nach Hause will, in die Heimat, in die Geborgenheit, muß sich dem Glauben zum Opfer bringen. Wer es aber mit dem Geist hält, kehrt nicht zurück.“ (Seite 342) Wer das Transzendente will, der muss dem Denken in seiner Unsicherheit entsagen. Es liegt also in der Natur des Denkens, dass es den eigenen Abgrund aushält. Das Denken bewegt sich im Nichts immer auf das Nichts zu, ist immer vom Nichts bedroht. Die Religion sucht ihr Heil in einem nicht wissbaren Transzendenten. Demgegenüber steht der Mensch, der in seinem individuellen Leben unvertretbar ist. „Wie sich die Welt als eine Individualität nur abhebt vom Horizont der Möglichkeit des auch anders sein Könnens, so hebt sich dem Menschen sein eigenes Dasein als individuelles nur gegen die Möglichkeit ab, daß er auch ein anderer hätte werden können.“ (Seite 343) Unser Dasein ist schlicht und ergreifend kontingent. Darüber hinaus ist aus der Perspektive der Gemeinschaft des “Wir“ jeder vertretbar – wie es etwa Heidegger in seiner Analyse des „Man“ gezeigt hat. Für sich selbst ist der Mensch unvertretbar, hinsichtlich der Mitwelt dagegen austauschbar. „Bewußtsein der Individualität des eigenen Seins und der Welt und Bewußtsein der Kontingenz dieser Gesamtrealität sind notwendig miteinander gegeben und fordern einander.“ (Seite 345) Dieses Über-sich-hinweg-Stehen des Menschen in Verbindung mit der Kontingenz der Welt (sie könnte schließlich auch ganz anders sein, als sie ist) nennt Plessner den „utopischen Standort“ des Menschen.
Warum beschäftigt man sich als Architekt mit Plessners Schriften? Was bedeuten seine Einsichten für die Architektur? Bauten sind Räume, die sich der Mensch selbst schafft. Dabei ist es doch einigermaßen interessant, dass man den Menschen unter drei Aspekten betrachten kann, bzw. vielleicht sogar betrachten muss: als Ding unter Dingen, als leiblich fühlendes und seelisch empfindendes Wesen und als Teil eines geistigen Miteinanders. Architektur bildet demnach die drei Weltsphären ab: die Außenwelt (das Geflecht der Dinge), die Innenwelt (die Welt der Atmosphären und der leiblichen Affekte) und die Mitwelt (Das Gewebe von Geist, Kultur und Gesellschaft). Dass Architektur diesen drei Sphären gleichermaßen gerecht werden muss, wird niemand ernsthaft bestreiten.