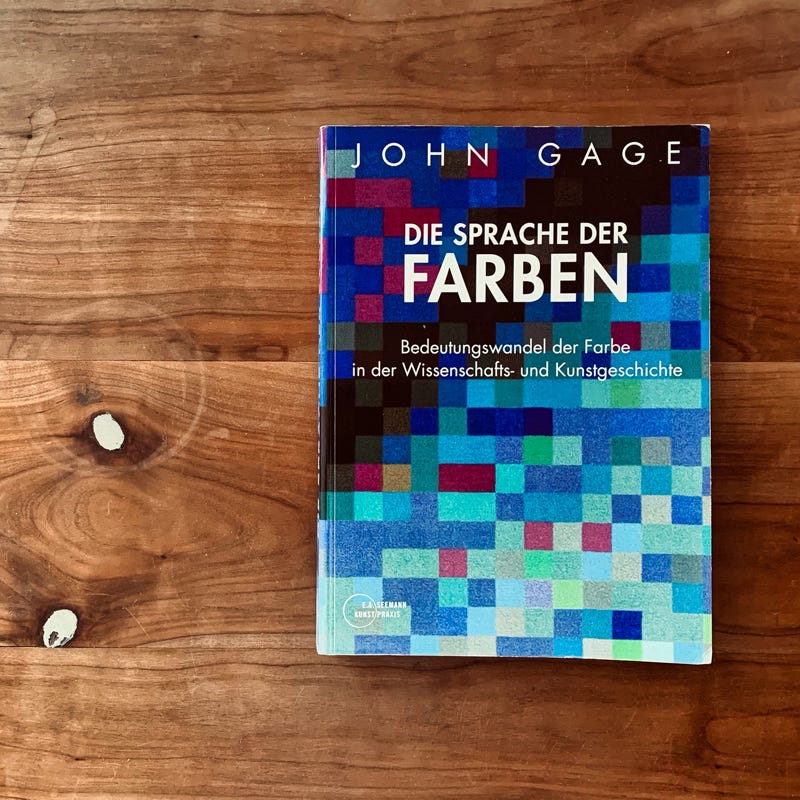
In 21 Kapiteln umkreist Gage das titelgebende Thema, ohne es je recht einzufangen. So verdienstvoll das Unternehmen sein mag, sich im Rahmen einer kunstgeschichtlichen Auseinandersetzung mit einer gestalterischen Substanz zu befassen. Weder gelingt es Gage, überhaupt herauszustellen, was Farbe im künstlerischen Sinne ist. (Anlehnungen an die Wissenschaftsgeschichte können hier vermutlich nicht weiterhelfen.) Noch macht Gage plausibel, was er als das Wesen der Sprache versteht und was die strukturelle Gemeinsamkeit mit der Farbe in der Kunst ist. Zwar gibt es vereinzelt Rückgriffe auf Wittgensteins Überlegungen zur Farbe („Über Gewissheit“). Eine Auseinandersetzung mit Wittgensteins ebenso grundlegenden Feststellungen zur Sprache, wie sie beispielsweise in den „Philosophischen Untersuchungen“ gegeben sind, führt Gage nicht. Der Sache fehlt das philosophische Fundament. Dieses hätte Gage nicht nur bei Wittgenstein, sondern eventuell bei DeSaussure, Heidegger oder meinetwegen den amerikanischen Sprachphilosophen finden können. So bewegt sich die Arbeit von Kapitel zu Kapitel elliptisch immer wieder um dieselben Themen und dieselben zitierten Autoren, ohne je zu einem klaren Ergebnis zu kommen.
Weiter wird in der Sache nicht klar genug differenziert zwischen „Ausdruck“, dem emotionalen Gehalt einer Sprache – analog dazu der Farben in ihrer Wirkung – und „Semantik“, der Trägerschaft wie auch immer gearteter Botschaften – das wäre die kulturell durchaus divergente Bedeutungsgeschichte verschiedener Farben. Darüber hinaus liegt Schwerpunkt auf der europäischen Kunst und Wissenschaftsgeschichte. Andere Kulturkreise kommen nur im Referat anthropologischer Betrachtungen der Sprachentwicklung verschiedener Völker vor. So bleibt der Einsatz der Farbe in der Kunst nichtwestlicher Kulturkreise völlig unterbelichtet. Ebenso wenig wird die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Betrachtungen mit einbezogen.
Der Band macht mehr den Eindruck einer losen Aufsatzsammlung zum Thema Farbe als den einer konsequent auf ein Ergebnis hin ausgerichteten Argumentation einer Monographie. Was ist das Thema, was sind die Prämissen, was sind die Thesen, wo liegen die Argumente hierfür und was ist das Ergebnis der Untersuchung? Symptomatisch endet das Buch mit dem 21. Kapitel abrupt mit einem kurzen Abriss über die Synästhesie der Farben. Es werden viele Themen angerissen, ohne Einordnung derselben ins ein größeres Ganzes.
Großes Plus dieses Buches über die Farbe ist sein immenser wissenschaftlicher Apparat. Literaturverzeichnis und Fußnoten sind eine wahre Fundgrube für Literatur zum Thema Farbe bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.




