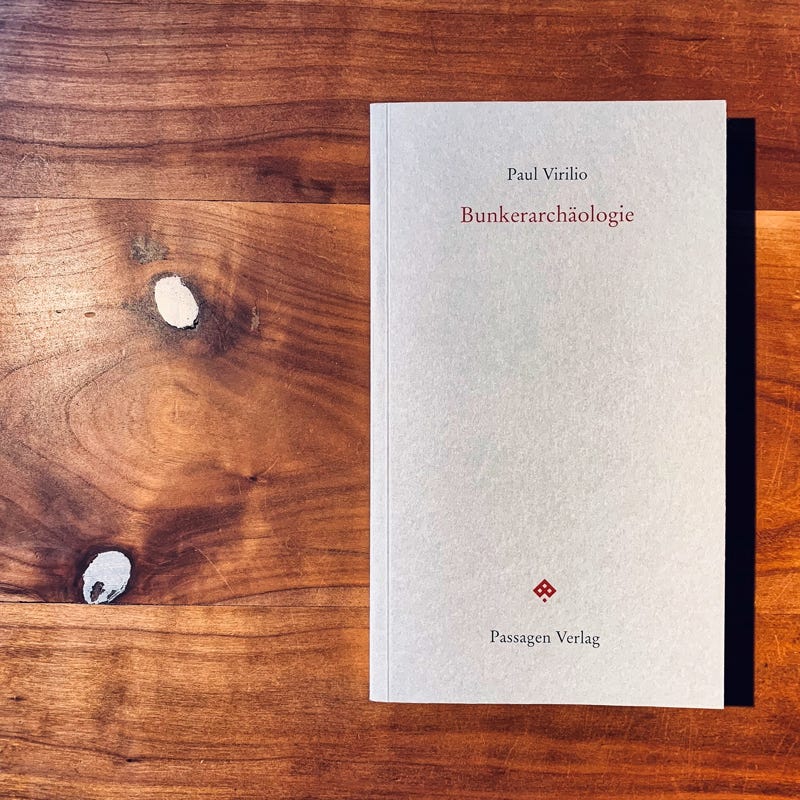
Vorab eine Bemerkung zu der hier vorliegenden Ausgabe des Passagen Verlags: Das äußerlich sehr ansprechende Bändchen ist leider verlegerisch derart liederlich gemacht, dass man es kaum glauben mag. Die gesamte Schrift wimmelt nur so von zum Teil sinnentstellenden Druckfehlern. Diesen Text hat niemand auch nur ein einziges Mal Korrektur gelesen. Aus „oft“ wird hier „fot“, Aus „Werk“ wird „Werker“ und mein persönlicher Favorit: „bis bin“ anstatt „bis hin“. Ich bespreche also nur den Text, nicht dessen Darbietung.
Bunkerarchäologie – der Titel ist etwas missverständlich. Es geht nicht um die Ausgrabung, Vermessung, Kartierung und Typisierung historischer Anlagen, so wie man etwa griechische Tempel katalogisiert. Der Bunker dient Virilio lediglich als Kristallisationspunkt zunächst einer Theorie des Militärischen Raums und dann darüber hinaus als Paradigma für die Entwicklung der Menschheit, die Moderne und die Globalisierung überhaupt. Die Bunkerarchäologie versteht sich in Wahrheit Phänomenologie. Am Bunker zeigt sich etwas. Er markiert für Virilio einen Wendepunkt in unserer Geschichte – den Übertritt in die totale Beschleunigung und damit einhergehend die Auflösung von Zeit und Raum in der Geschwindigkeit. Der Bunker ist der letzte, vergebliche Versuch dem entgegenzutreten.
Die Beschleunigung gipfelt in ihrem Extrem in der Auflösung der Materie in Energie. Die Atombombe ist die militärische Erscheinung dieses Übertritts. Den so von uns selbst entfesselten Gewalten sind wir schutzlos ausgeliefert. Im Angesicht des Atomkriegs ist der Bunker ein lächerliches Relikt eines vergangenen Zeitalters. Er markiert für Virilio als wahrhaftiges Monument einen, wenn nicht den, Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit in dem sie beginnt sich selbst zu überholen.
Virilio reiht sich hier unter den technik-skeptischen Denkern der Moderne ein – Martin Heidegger, Günther Anders, Marc Augé, um nur ein paar zu nennen.
Warum gilt gerade dieser Text vielen Architekten als Manifest? Was sagt uns dieser Text? Im Bunker treten verschiedene Aspekte des Architektonischen auf Grund der extremen Situation, für die er entworfen ist, übersteigert hervor:
1) Die Verstärkung der Schutzfunktion. Nicht Wind und Wetter gilt die Hülle des Bunkers, sondern Projektilen und Geschossen, Feuer und Stahl. Der Bunker ist eine extreme Form des Sich-Verhüllens. Er ist ein „verstärktes Haus“.
2) Dadurch tritt die Nähe der Architektur zur Bekleidung in besonderer Weise hervor. Der Bunker weist eine gesteigerte anthropomorphe From auf.
3) Das Gefügt-sein aus verschiedenen Bauteilen wird beim Bunker zu Gunsten der Herstellung aus „einem Guss“ verschoben. Er ist ein Teil, Mono-Lithos, aus einem Stein. Er bildet dadurch gegenüber dem aus einer Unzahl unterscheidbarer Teile bestehenden Geflecht einen extremen Pol im Spannungsverhältnis des architektonischen Fügens.
„Bei Backstein- oder Steinbauten, das heißt bei Verbindungen von Einzelelementen, ist das Gleichgewicht der Gebäude Funktion First-Fundament. Beim Betonblockbau ist es der Zusammenhalt des Materials selbst, der diese Rolle übernehmen muß: der Schwerpunkt ersetzt das Fundament.“ (Seite 77)
Der Bunker ist eine architektonische Gestalt aus einem Guss. Diesen phänomenologischen Beobachtungen gilt das Interesse des Architekten. Im Bunker analysiert Virillio eine extreme Form der menschlichen Befindlichkeit und deren Behausung. Architektur in ihrer relativen Beständigkeit steht quer zur Zeit. Damit ist sie der natürliche Antipode zur fortwährenden Beschleunigung und Virtualisierung der globalen Gesellschaft.
In dieser Einsicht liegt auch der philosophische Wert des Textes. Virilios mehr oder weniger geistreichen Einlassungen zum Dritten Reich im Allgemeinen und zu Albert Speer im Besonderen kann man getrost übergehen. Es sind die phänomenologischen Betrachtungen eines architektonischen Archetyps, die Virilios Bunkerarchäologie noch heute lesenswert machen.




