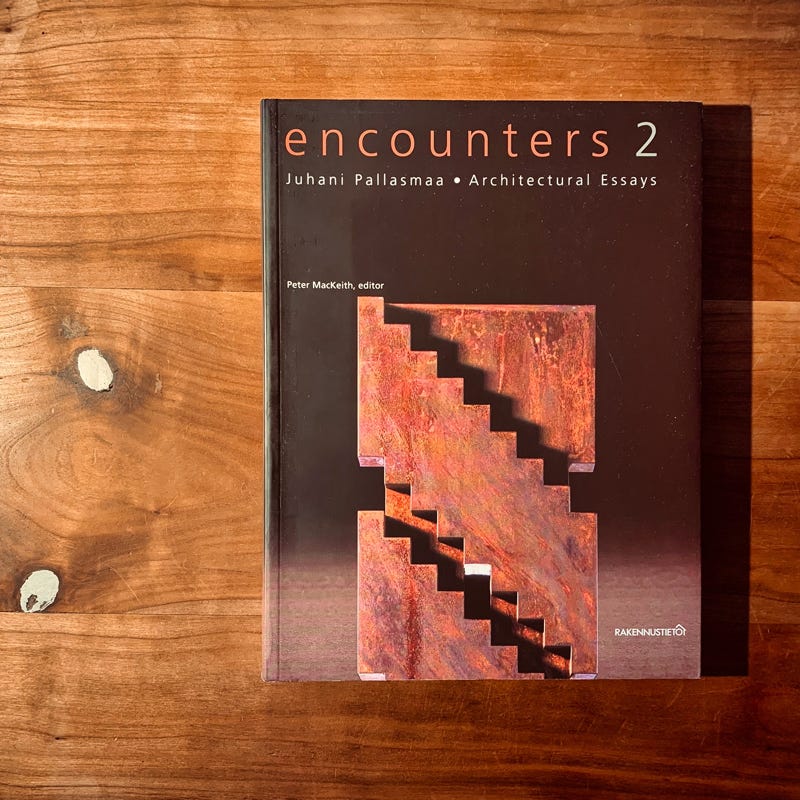
In „Encounters 2“ setzt Juhani Pallasmaa seine Überlegungen zur existenziellen Bedeutung der Architektur fort. Die hier gesammelten Aufsätze sind hauptsächlich aus den 2000er Jahren und umfassen die so überschriebenen Themengebiete Architectural Essences –Artistic Portraits – Meaning in Architecture – Architectural Portraits – Boundaries – Architecture of the Arts.
Ich greife einige der Essays in ihren Kernaussagen heraus, die mir besonders wichtig erscheinen.
1) Space, place, memory and imagination
In diesem Aufsatz untersucht Pallasmaa ansatzweise den Zusammenhang zwischen Architektur und Emotion. Für manche Bautypen liegt dieser auf der Hand – Monumente, Grabbauten, Museen, Sakralbauten – für andere weniger. Dennoch haben alle Bauwerke, in denen wir uns bewegen einen mehr oder weniger starken Einfluss auf unsere Befindlichkeit, ganz gleich, ob dieser gewollt ist oder nicht.
Die Emotionalität der Architektur ist eng mit unserer zeitlich-ekstatischen Verfassung verwoben. Wie Architektur uns bewegt, hängt damit zusammen, welche Erinnerungen sie in uns wachruft, welche Erwartungen sie weckt, welche Möglichkeiten sie offenlässt und wie sie unsere Gegenwart erfüllt. In der Architektur überlagert sich unser zeitliches Über-uns-selbst-hinweg-sein in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit unserer räumlichen Erstrecktheit (Ekstatik), in der wir zugleich hier und dort sind.
Umgekehrt bleibt Architektur uns gegenüber nicht passiv, sondern sie übt eine Wirkung auf uns aus: „buildings are […] amplifiers of emotions; our constructions reinforce sensations of belonging or alienation, invitation or rejection, tranquility or despair.“ (Seite 30) Bauten wecken Gefühle. Sie haben eine gewisse Anmutung, allzu oft sind sie sogar eine Zumutung. Im Vergleich zu anderen Künsten ist Architektur allerdings eine Kunst der leisen, beziehungsweise der langsamen Emotionen. Ihr Ziel ist nicht der Affekt, wie ihn etwa das Drama, der Film oder die Musik ansprechen. „Architecture’s role is not to create strong foreground figures or feelings, but to establish frames of perception and horizons of understanding. The task of architecture is not to make us weep or laugh, but to sensitize us to be able to enter all emotional states.“ (Seite 31) Architektur stimmt den Grundton im Orchester unserer Gefühle.
2) The Limits of Architecture
In diesem Aufsatz wendet sich Pallasmaa gegen den Anspruch der Stararchitekten-Kultur auf permanente Neuheit. Er beruft sich dabei auf keinen Geringeren als Adolf Loos, der schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Angemessenheit von Form und Material über deren Novität stellte. Architektur dient der menschlichen Existenz und nicht dem Architekten. Sie muss also folglich dieser Existenz angemessen sein. Die Gesetzmäßigkeiten unserer Architekturerfahrung haben sich nicht geändert, seit der Mensch begonnen hat zu bauen. Vielleicht verstehen wir diese Gesetze der Wirkung unserer gebauten Umwelt auf uns ein wenig besser und vielleicht haben wir technisch ein paar Möglichkeiten dazu gewonnen, grundsätzlich aber bleibt das Architekturerlebnis dasselbe, wie vor tausend oder zweitausend Jahren. Es besteht also keine Veranlassung immer neue technische Möglichkeiten aufzubieten, um immer spektakulärere Bauten zu realisieren, wenn nicht nachvollziehbar ist, dass diese Bauten unserem Wesen besser entsprechen. So betrachtet trägt Architektur ihre eigene Grenze in sich, indem sie nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie dem Menschen in seinem Wohlbefinden dient.
3) An Architecture of Violence – On Atmosphere Wir alle kennen bestimmte atmosphärische Verdichtungen in Filmen, insbesondere wenn Gewaltdarstellungen zu deren Erzählung gehören. Es wird eine bestimmte Musik unterlegt, bestimmte Räume werden gezeigt, ein bestimmtes Verhältnis von Licht und dunkel wird hergestellt. All das erzeugt zum Beispiel eine Atmosphäre der Bedrohung. Pallsammaa sieh ähnliche Erscheinungen auch in unserer Altagsarchitektur am Werk, und behauptet, dass es so etwas, wie „atmosphärische Gewalt“ auch in der Gegenwartsarchitektur gibt.
„More difficult to notice, yet still just as real, are the instruments of architectural violence created by buildings and urban spaces. Disorientation and getting lost, claustrophobia and agoraphobia, alienation and the experience of existential placelessness, vertigo and a fear of falling, a super-human scale and a threatening scale, paralyzing repetition, sensory deprivation and the overloading of the senses, and control and surveillance. Architecture thus possesses a surprisingly extensive selection of instruments for causing anxiety and subordination.“ (Seite 203) Das ist in der Tat eine ganze Reihe von Phänomenen architektonischer Gewalt. Ein Paradigma für gewaltsame Bauten ist das Labyrinth als Ort, beziehungsweise Un-Ort der Desorientierung, des Kontrollverlusts durch eine unlogische, unverständliche und dadurch feindliche Umwelt in der man gleichzeitig ausgesetzt und eingeschlossen ist und trotz Bewegungsraum in der Desorientierung gefangen ist. Pallasmaa findet weitere Beispiele architektonischer Gewalt: alle Formen der Überwachungarschitekturen; Gefällesituationen, die unserem Sinn für Gleichgewicht und Höhe widerstreben; diktatorische Ordnungen, in denen kein Raum mehr ist für Andersartiges bleibt; Spiegelungen, die zu einem Verlust der Realität führen und so fort.
Der architektonischen atmosphärischen Gewalt stellt Pallasmaa in „On Atmosphere“ eine umfassendere, positive Betrachtung des Atmosphärischen in der Architektur gegenüber. Noch bevor wir Einzelheiten unterscheiden, haben wir ein Gefühl für die Atmosphäre einer komplexen Situation. Es ist ein Gefühl, das eine Ganzheit erfasst. Erst im Anschluss daran und auf der Basis dessen beurteilen wie Einzelheiten. Diese Erfahrung einer Atmosphäre ist multisensorisch und übersteigt die klassischen „fünf aristotelischen Sinne“, indem es darüber hinaus „senses, such as those of orientation, gravity, balance, stability, motion, duration, continuity, scale and illumination“ (Seite 239) umfasst. Diese „Umweltfaktoren“ der Atmosphäre werden zudem durch soziale und kulturelle Aspekte überlagert. Der Begriff der Atmosphäre bleibt deshalb immer unscharf, weil für eine Atmosphäre immer viele Faktoren ausschlaggebend ein können, die im Nachhinein vielleicht nicht einmal alle benannt oder gar analysiert werden können. Fest steht, das Atmosphären mit unserem Befinden untrennbar verknüpft sind. Beispielhaft für den Zusammenhang von künstlerisch erzeugten Atmosphären und unseren Stimmungen ist die Musik. Hier überträgt sich eine klanglich gestaltete Atmosphäre direkt auf unsere Befindlichkeit. In der Architektur ist das Nachdenken über Atmosphären nicht so selbstverständlich. „Among architects, atmosphere is judged as something romantic and shallowly entertaining.“ (Seite 241) Das ist eine etwas pessimistische Einschätzung. Auch im Zuge der zweiten, „anderen“ Moderne gibt es über die Hinwendung zum Material entscheidende Experimente mit Atmosphären. Auch nach der Überwindung der Postmoderne und des Dekonstruktivismus gibt es in der Gegenwart durch die Aufwertung des Stoffs gegenüber architektonischen Formalismen eine Aufwertung des atmosphärischen. Dennoch stehen seit langem technische, funktionale, ökonomische und ökologische sowie formal ästhetische Fragestellungen in der Architektur im Vordergrund. Eine systematische Erforschung des Phänomenfeldes der unterschiedlichen in der Architektur wirksamen Stimmungen und Atmosphären findet nicht statt. Pallasmaa äußert hier die Vermutung, dass die meisten atmosphärischen Phänomene jenseits des Formalen und des Visuellen zu suchen sind. Tiefergehende Einsichten liefert jedoch auch er hier nicht.
Auch im zweiten Band von „Encounters“ widmet sich Pallasmaa einer Reihe wichtiger Themen der Architekturtheorie. Es liegt in der Natur des Essays, dass hier nicht in die Tiefe gegangen wird. Dennoch liefern Pallasmaas Überlegungen eine Vielzahl von Denkanstößen, die die eigenen Überlegungen zur Architektur bereichern können. Pallasmaa bleibt einer der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Architekturtheorie.




