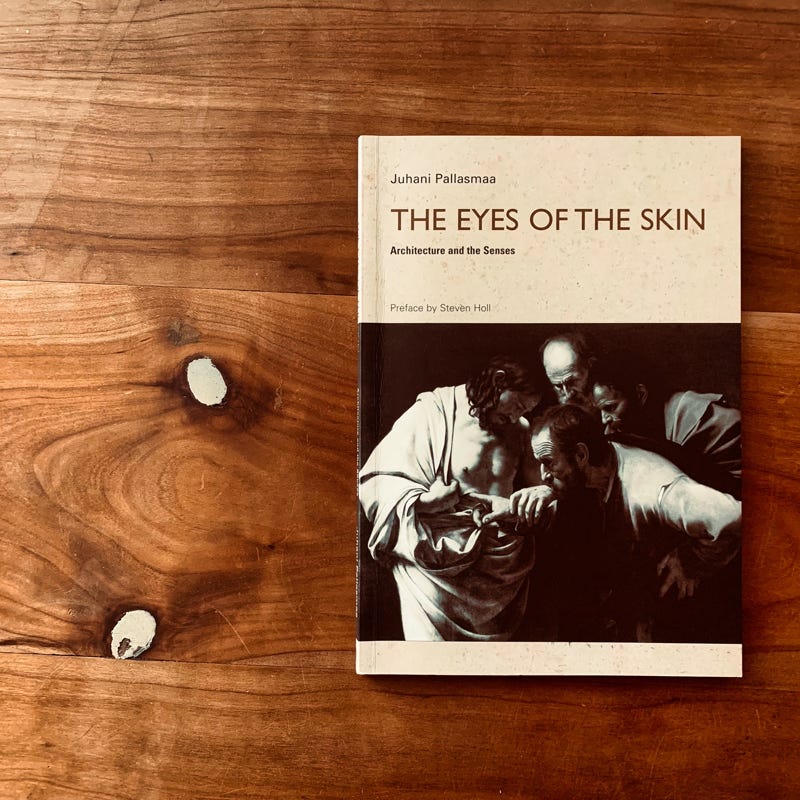
Der Essay gliedert sich in zwei Teile. Grundthese der Schrift: Alle Sinne gehen aus dem Tastsinn hervor, das heißt alle Sinne sind letztlich Erweiterungen des Tastsinns. Eine Auseinandersetzung mit Aristoteles, der in „De Anima“ eine ähnliche Haltung vertritt, findet natürlich nicht statt. Genauso wenig nimmt Pallasmaa Bezug auf Michel Serres. Auch die gelegentlichen Verweise auf Martin Heidegger sind wenig erhellend. Zunächst geht es Pallasmaa um eine Kritik an der Hegemonie des Sehsinns in der Architekturtheorie. Eine solche Kritik ist sicher notwendig. Wie das Gehör, ist das Sehen ein sogenannter Fernsinn. Im Visuellen liegt eine Distanz. Was aus der Ferne betrachtet werden kann, fordert keine persönliche, leibliche Interaktion, lässt uns seltsam uninvolviert. Vom Visuellen zum Virtuellen ist es dann nur ein kleiner Schritt. Wenn sich in der Architektur und ihrer Theorie also eine Tendenz zur Selbstvisualisierung feststellen lässt, dann wäre ihre Virtualisierung der nächste konsequente Schritt. Kann es denn eine rein virtuelle Architektur wirklich geben? Eine Architektur, die sich nicht mehr um unsere vielsinnige, leibliche Befindlichkeit kümmert? – Eigentlich nicht! Überall dort, wo sich Architektur von ihren archaischen Ursprüngen entfernt, beginnt sie sich selbst zu verlieren. Es gibt bereits im 20. Jahrhundert eine gegenläufige Tendenz zu einer sich in einer visuellen Formensprache verlierenden Architektur: die sogenannte „Andere Moderne“. Pallasmaa ruft in seinem Essay die Granden des vergangenen Jahrhunderts auf: Wright, Aalto und Kahn (Seite 35).
Der Kritik des Visuellen stellt Pallasmaa im zweiten Teil eine positive Darstellung unserer leiblichen Erfahrungen der Architektur gegenüber. Es bleibt leider beim Versuch. Der Leser erfährt hier wenig neues. Es ist vielmehr eine serielle Anrufung von Zeugen: Wright, Bachelard, Okakura, Valéry, Tanizaki, Barragan und viele weitere kommen zu Wort, um verschiedene Aspekte der Architektur zu beschreiben. Es geht um Proportion, Licht und Schatten, Akustik, Stille, Geruch und sogar Geschmack der Architektur (John Ruskin wird hier aufgerufen). Vieles wird angerissen, wenig zu Ende gebracht. Pallasmaa versucht Architektur in der Folge als Vollzug, das heißt als Geschehen zu denken – „verbal“, wie er sagt. Was er übersieht: zum Geschehen in der Architektur, gehören immer bestimmte Verhältnisse, die sich sprachlich nicht allein durch Verben benennen lassen. Es sind vielmehr die Präpositionen, die hier die Hauptlast der Bedeutung tragen – die Verhältnisworte. Architektur gibt Raum für ein Geschehen, setzt dabei ins rechte Verhältnis und ist doch selbst Wirkung und Verhältnis ihrer Verschiedenen Teile zugleich.
Pallasmaas Essay ist in vielem ein Anfang, ein Versuch. Man kann die Schrift als Impulsgeber für eigene Nachforschungen lesen. Antworten darf man hier keine erwarten. Pallasmaas Stärke sind kurze, prägnante Aufsätze, tiefgreifende Auseinandersetzungen mit einem Thema sind es nicht.




