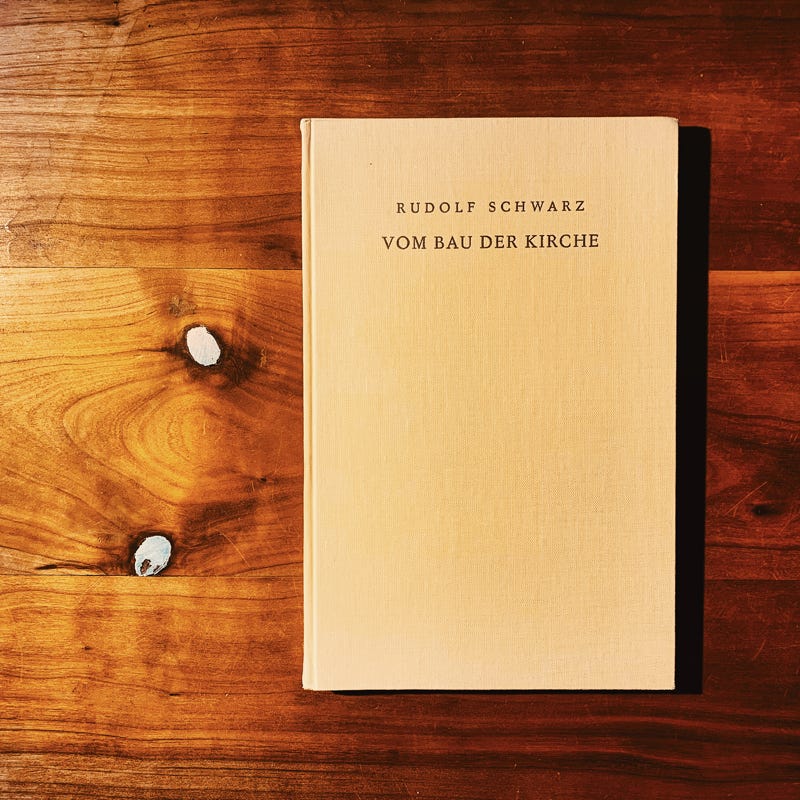
„Vom Bau der Kirche“ ist neben „Von der Bebauung der Erde“ das zweite theoretische Hauptwerk des Kölner Architekten Rudolf Schwarz. Man kann sagen, beide Texte bilden eine Einheit. Sie handeln von heiligen und weltlichen Bauten. Beide Texte sprechen aus einer dezidiert christlichen, das heißt katholischen, Weltsicht heraus.
In sieben Bildern – er selbst nennt sie „Pläne“ – entwirft Schwarz eine Theorie des Sakralbaus als Ort der Versammlung der Menschen vor Gott. Das Erste Bild zeigt das Heiligtum als Ring, als von der profanen Welt abgegrenzten Raum – temenos oder templum. Der Ring hat eine Mitte, die er umschließt. Diese Mitte ist das Zentrum seines Sinns. Aus dem Ring ergibt sich die Kugel, beziehungsweise der Rundbau. Es ist die Form prähistorischer und antiker Heiligtümer, die im Pantheon ihren unübertroffenen Zenit erreichen. Das Christentum zerbricht diese Form und gründet sie neu. Das zweite Bild ist folglich der offene Ring. Dieser öffnet sich dem Unendlichen, dem apeiron, das der Antike so unheimlich gewesen ist. Die Öffnung stellt einen Übertritt dar, vom Weltlichen zum Ewigen. Das Licht fällt über den Altar auf die Gemeinde. „Das ist die >Schwelle< zwischen Diesseits und Jenseits. So wurde aus dem inneren Ring, mit dem die Erde an die Ewigkeit grenzte, der Küstensaum, die Kante des Wasserfalls.“ (Seite 51) Die Kirche ist ein Ort des Übertritts. Der Altar ist der Punkt, an dem dieses Ereignis geschieht. Das dritte Bild versteht die Kirche als „lichten Kelch“. Beispiele sind „Santa Constanza“ in Rom und die „Hagia Sophia“ in Konstantinopel. Räume, die von einem überirdischen Licht erfüllt werden, dessen Ursprung selbst im Dunkel bleibt. Es verschneiden sich zwei Prinzipien der Raumordnung: der Zentralbau, der sich in Ringen um eine Mitte ordnet und die Führung des Lichts, das von oben herabfällt. Schwarz fasst dieses Geschehen als Streit: „Gegenstand dieses Entwurfs ist der uralte Kampf zwischen Mensch und Erde, und in ihm steht der Mensch für das Leichte, das Lichte und Klare gegen das Schwere, Dunkle und Ungestalte, für das Zarte gegen das Massige. Er entwindet sich der Erde und der Umschlingung […]“ (Seite 69) Das vierte Bild ist der Weg. Die Kirche bildet eine breite Straße hin zu Gott. Der Weg impliziert Bewegung und Richtung. Schwarz beschreibt die Ausrichtung des Menschen – ähnlich Plessner – als Achsenkreuz der Richtungen vorne – hinten, oben – unten und links – rechts. Wobei die Pole dieser Richtungsachsen nicht gleichwertig sind. Das Nach-vorne hat eine höhere Bedeutung als das Hinten. Die Gemeinde wiederum, die die Kirche „bildet“, ist eine Gemeinschaft auf dem Weg in dieselbe Richtung, hin zu Gott. Der Kirchenraum begleitet und gliedert die verschiedenen Abschnitte dieser „Prozession“. Das fünfte Bild begreift das Leben als „Wurf“, der aufsteigt und fällt, Anfang, Bahn und Ende. Anklänge an Heideggers Theorem der „Geworfenheit“ sind sicher kein Zufall. Die Kirche ist auch ein Weg in den Tod und mit ihm in die Erlösung. Das sechste Bild zeigt den Kirchenraum als „All“, als Himmelsgewölbe. Das Licht selbst wird zum Baustoff, Manifestation des Transzendenten. Verwirklicht sieht Schwarz dieses Bild in der Pilgerkirche „Vierzehnheiligen“, Neresheim. Das siebente Bild – der Dom aller Zeiten (das Ganze) – meint gar keinen konkreten Kirchenraum mehr. Schwarz versteht die sechs bereits dargestellten Pläne als durch eine heilsgeschichtliche Abfolge verbunden. Das siebte Bild vereinigt die vorangegangenen Sechs als Teile eines größeren, göttlichen Plans. Hier im Ideellen ist der Kirchenbau alles zugleich, Weg und Zentrum, Anfang und Ende, Aufbruch und Übertritt, Lichtspiel und Gefäß, Diesseits und Jenseits, vergänglich und ewig.
Ganz am Ende reflektiert Schwarz die Reichweite der eigenen Theorie: „Diese >Pläne< sind keine Musterentwürfe, denn sie setzen gerade dort aus, wo die Entscheidungen fallen müßten, aus denen sie >konkret< werden könnten. In einem Zustand der Verhaltenheit verharren sie hinter der Verwirklichung, in die hinein man sie mannigfaltig interpretieren kann. Erst in einer, dieser, oder jener der vielen möglichen Auslegungen würden sie echte Entwürfe.“ (Seite 145) Auch das Überirdische muss sich am Ende in Stoff und Form zeigen.
In Schwarz‘ Schriften mischen sich tektonische Formenlehre, Beschreibung räumlicher Gestalten und theologische Versenkung zu einem Ganzen. Der Glaube gewinnt Gestalt. Mit einer pathosgeladenen, fremden Sprache zieht er den Leser in seinen Bann. Wer keine Angst hat vor dem Befremdlichen, kann sich hier in die geistige Welt eines großen Kirchenbaumeisters der deutschen Nachkriegsgeschichte entführen lassen.




