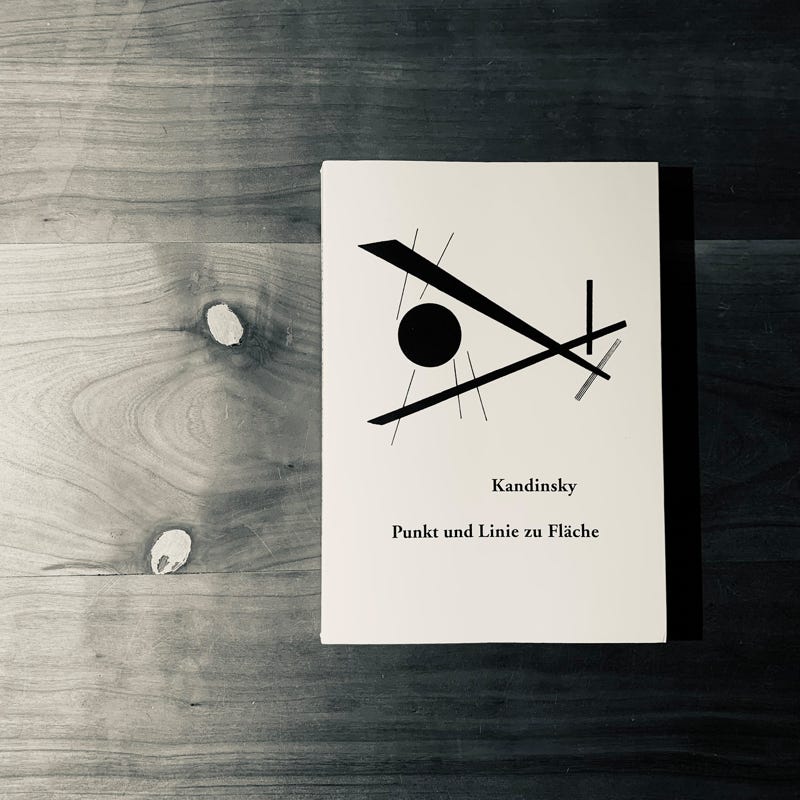
Ich lese den Text als Architekt. Gerade für die Architektur, deren zweidimensionale Darstellung sich in Punkten, Linien und Flächen bewegt, scheint mir dieser Text besonders aufschlussreich. Man denkt beim Lesen ständig darüber nach, welche Auswirkungen die verschiedenen hier analysierten und dargestellten Beobachtungen zur Linienführung – ins räumliche transponiert – wohl auf einen fiktiven Bewohner haben würden. Kandinsky selbst deutet den Zusammenhang zwischen graphischem Phänomen Linie und Architektur mehrfach an. (Seite 109)
Die Grundthese der Schrift lässt sich so zusammenfassen: verschiedene Punkt-, Linien und Flächenkonstellationen üben unterschiedliche emotionale Wirkungen auf den Betrachter aus.
Ausgehend vom Punkt, der die konzentrierteste und minimale graphische Form darstellt, versteht Kandinsky alle malerischen Formen als Spiel von Kräften und Gegenkräften, als Gegensatz von Ruhe und Bewegung. In jeder komplexen Form und in jedem ihrer Elemente, leben Kräfte, beziehungsweise Spannungen, die der Form ihre Bewegtheit, beziehungsweise ihre Ruhe verleihen, das heißt ihr „Leben“ bestimmen. So gesehen lassen sich Teilformen einer Gestaltung als Elemente auffassen, vergleichbar den Tönen in der Musik. Aus dem Spiel dieser formalen Elemente ergeben sich Zusammenklänge, die den Akkorden der Musik vergleichbar sind und die sich wiederum zu Sequenzen, Takten und Komplexen Stücken fügen. Schließlich greift auch die musikalische Notation (ebenso wie die Architektur) auf Punkte und Linien verschiedenster Art zurück, um das künftige Werk in seiner Aufführung vorwegzunehmen. Aus Punkten ergeben sich durch Kraft und Bewegung Linien, woraus sich dann Formen und Flächen bilden. Der Punkt ist in sich geschlossene, ruhende Form. Die Linie dagegen ist Bewegung. Sie ist Dynamik, das heißt Kraft. Zwei Dinge spielen bei der Bewegung eine Rolle: die Kraft (Spannung) und die Richtung. „Wie“ eine Linie verläuft, macht einen Unterschied. Die Gegensätze oben-unten, rechts-links und räumlich gedacht vorne-hinten kommen ins Spiel und geben jeder Linienführung ihren „Klang“. Weiter macht es einen Unterschied, „wie“ sich das Spiel der Kräfte in der Linie selbst entfaltet. Wird die Linie durch Kraft und Gegenkraft erzeugt, so dass mal die eine, mal die andere Kraft überwiegt und so die Richtung der Bewegung bestimmt, ergibt das die gebogene oder gewellte Linie. Wird die Linie durch Kraft und Gegenkraft gebrochen, so entsteht die eckige Zick-Zack-Linie. Beide Typen haben völlig unterschiedliche Anmutungen und es ergeben sich völlig unterschiedliche atmosphärische Qualitäten der so erzeugten linearen Elemente. Daraus folgen Gegensätze in der Wirkung, wie etwa passiv – aktiv, aggressiv – ruhig, warm – kalt, hart – weich, schnell (hektisch) – langsam. Das sind verkürzt dargestellt synästhetische Wirkungen, die verschiedene Linienkonstellationen auf uns ausüben. Formen sind also nicht „in abstracto“ gegeben, sondern haben ganz klar leibliche Wirkungen. Aus Linien ergeben sich von selbst Flächen, die wiederum ihre Qualitäten aus dem Zusammenspiel verschiedener Teilformen erhalten. Es ist nur konsequent, dass dann auch verschiedene Bildformate eine klare emotionale Sprache sprechen. Aus dem Zusammenspiel der Formen des Bildes und der Formen im Bild ergibt sich das Ganze der Bild-Gestalt.
Kandinskys Essay lässt sich als ästhetische Analyse der Form in ihrer Wirkung auf den Betrachter verstehen. Aus den verschiedenen Wirkungen linearer Elemente auf unsere Stimmung versucht Kandinsky eine Ordnung der verschiedenen Linien- und Formentypen zu entwickeln, ganz analog zu einer emotionalen Ordnung der Farben. Konsequent bringt er verschiedenen Formen mit unterschiedlichen Farbeindrücken zusammen, die mit deren atmosphärischen Qualitäten zusammenhängen. Erinnert man sich an gestaltpsychologischen Einsichten etwa bei Wolfgang Köhler oder Rudolf Arnheim, so ergibt sich ein umfassendes Bild der emotionalen Wirkmächtigkeit der gestalteten Form. Kandinsky bietet hier nichts weniger als den Ansatz zu einer Wirkungslehre der Form. Damit gehört dieses Buch zu den wichtigsten Schriften der Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts und ist heute so aktuell wie eh und je.




