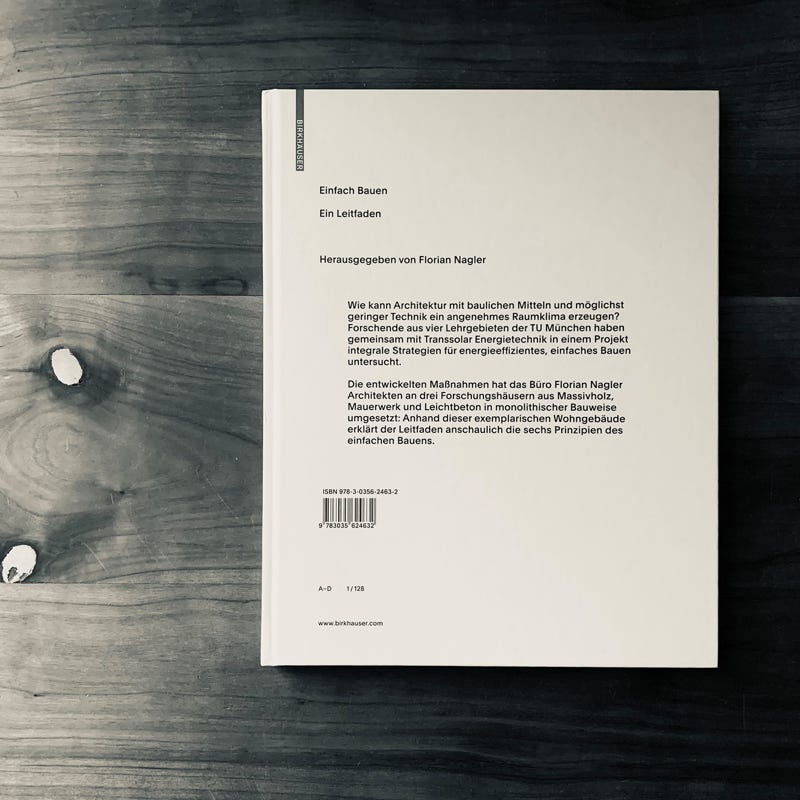
Es geht um drei Musterhäuser, die Nagler für den Bauträger B&O Gruppe in Bad Aibling, süd-östlich von München gebaut hat. Diese drei Bauten geben Antwort auf die Frage: Wie können wir im Angesicht der Kostenexplosion am Bau einerseits und der Klimakrise andererseits überhaupt noch bauen? Wie man sieht, das geht!
Wie Nagler selbst in seinem Vorwort beschreibt, treibt auch ihn das Unbehagen vor der zunehmenden Automatisierung der Haustechnik einerseits und andererseits die schon fas wahnsinnig steigenden Baukosten. Wie er ausführt, gibt es hier einen direkten Zusammenhang, denn der Anteil des technischen Ausbaus an den Baukosten steigt mit diesen überproportional, in den letzten 15-20 Jahren etwa doppelt so schnell, wie die übrigen Baukosten. Das ist nur eine Erkenntnis bezüglich der Technik. Nimmt man hinzu, dass 80% der Kosten, die ein Gebäude verursacht, im Betrieb entstehen, dann versteht man sofort, dass im Bereich der technischen Ausstattung das größte Einsparpotential liegt. Der Technikverzicht ist also keine ideologische, sondern eine ökonomische Haltung.
Hinzu tritt für Nagler die Frage nach der Sinnfälligkeit der Gebäudeautomation. Die durch Lüftungsanlage, Heizungs-Steuerung und Co. rechnerisch erreichbaren Energieeinsparungen stellen sich in der Praxis zu selten tatsächlich ein. Darüber hinaus, je komplexer die Haustechnik und ihre Steuerung, desto aufwändiger sind Monitoring und Wartung und desto anfälliger werden die Systeme für Störungen. Das will sagen, das Ganze funktioniert bestenfalls auf dem Papier. Aber nicht nur der Betrieb der hochgezüchteten baulichen Infrastruktur ist kompliziert, die Erstellung ist es mindestens genauso. Mit den technischen Anforderungen steigt der Planungsaufwand exponentiell bis hin zu einer Grenze, an der das Scheitern ganzer Projekte vorprogrammiert zu sein scheint. Je komplexer ein Bauwerk, desto höher die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender konstruktiver Fehler in der Ausführung. Dies alles regt Nagler nach eigener Aussage dazu an darüber nachzudenken, „ob wir nicht auch mit etwas reduzierten Ansprüchen und einfacheren, aber robusteren Mitteln zu schönen, gut bewohnbaren Häusern gelangen können und dabei dennoch aufgrund eines angemessenen Energie- und Ressourcenverbrauchs, unserer Verantwortung für die gebaute Umwelt gerecht werden.“
Die Antworten auf die beiden großen Herausforderungen unseres Berufsstandes – Kostenexplosion und Klimawandel / Energiekrise – sind demnach Reduktion auf das Wesentliche und Verhältnismäßigkeit. Dabei geht es nicht allein um Verzicht – das ist nur ein Teil, obwohl es jedem klar sein muss, dass es so nicht weiter geht – sondern um die richtige Anwendung der Mittel, die Nagler und seine Mitstreiter aus einem ganz pragmatischen Ansatz heraus bewerten. Sie betrachten hauptsächlich wirtschaftliche und bauphysikalische Faktoren, weil sich diese für eine rechnerische Aufarbeitung am besten eignen. Exemplarisch wird eine Geschosswohnung mit einem sogenannten „Tiny House“ verglichen. Im Ergebnis ist das Mini-Haus in seiner Wohnfläche auf ein Viertel der Fläche der Wohnung reduziert, weist aber dennoch das doppelte an Hüllfläche auf. Das ist nicht nur in energetischer Hinsicht fatal, denn auch was die Baukosten betrifft, sind alle der Witterung ausgesetzten Bauteile um ein Vielfaches teurer als Bauteile, die nicht den Elementen trotzen müssen. Das rechte Verhältnis von Hülle zu Volumen spielt demnach eine wesentliche Rolle für die ökologische, wie auch die ökonomische Effizienz eines Gebäudes.
Die grundlegende Frage dieses Buches ist also, die nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel in Bezug auf unsere gebaute und bewohnte Umwelt. Man könnte diesen Ansatz um eine psychologische oder phänomenologische Betrachtungsweise erweitern, indem man sich fragt, wie sich Form, Proportion, Farbe, Licht, Materialität usw. auf unsere Befindlichkeit auswirken und wie diese Wirkungen mit den in diesem Buch gefundenen Zusammenhängen interagieren. Denn Architektur besteht nicht allein aus technischen Mitteln, sondern vielmehr noch aus gestalterischen Elementen. Was die Frage gestattet, ob sich nicht über die richtige Auswahl der gestalterischen Mittel, viele technischen Klimmzüge
Ich muss sagen, dass mich Naglers kleines Buch tatsächlich ein gutes Stück weitergebracht hat. Sein Beitrag stellt die Frage der ökonomischen Verhältnismäßigkeit neu, indem er gleichzeitig dem Reflex widersteht, durch zunehmende Technisierung der Gesellschaft im Informationszeitalter entstandene Probleme technisch zu lösen. Der Ansatz, Gebäude so einfach, wie nur irgend möglich zu erstellen, scheint mir für die absehbare Zukunft der einzig erfolgversprechende zu sein, wenn es darum geht Wohneigentum für eine breite Schicht der Bevölkerung möglich zu machen und nicht allein für wenige Privilegierte. Bauen wird wieder zunehmend zur sozialen Frage. Es wird sich in naher Zukunft sehr wohl zeigen, dass die ökologische und die soziale Frage eng miteinander verbunden sind – es wahrscheinlich immer schon waren. Wir Architekten müssen hier theoretische und praktische Antworten liefern, wenn wir den großen Konzernen und der Politik nicht das Feld überlassen wollen.




