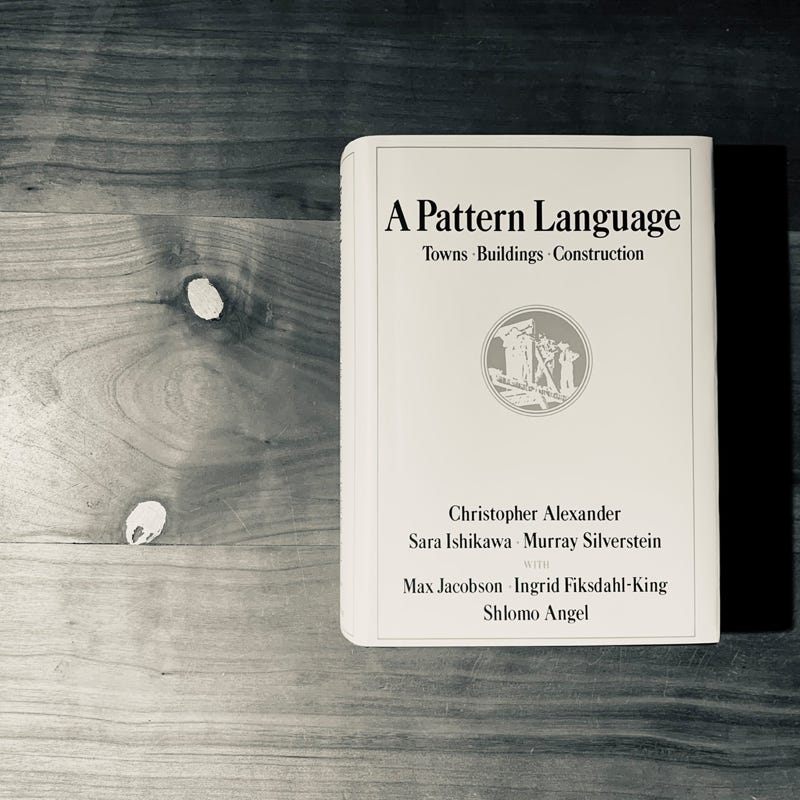
Der Band selbst gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Teil – „Towns“ – beschäftigt sich mit regionalplanerischen und städtebaulichen Themen. Der zweite Teil – „Buildings“ – konzentriert sich auf das Wohnen und das Wohnumfeld und die dafür nach Ansicht Alexanders erforderlichen Räume und raumerzeugenden Elemente. Der dritte Teil – „Construction“ – handelt von der konkreten Ausformulierung der raumgestaltenden Muster des 2. Teils. Die Bewegungsrichtung der Schrift ist dadurch klar, es geht vom Großen ins Kleine, auch wenn Alexander immer wieder betont, dass dies nicht der Fall sei. Letztlich beschreibt er die Übliche Herangehensweise in unserem Beruf. Man beginnt mit der städtebaulichen Situation und gelangt über konkrete Raumgestaltungen schließlich zu den baulichen Details. Selten fängt man mit einem konstruktiven Detail an und entwickelt daraus ein Gebäude und schließlich einen städtischen Raum.
Der Anfang des ersten Teils wirkt für mich als Architekten eher ein wenig aus der Zeit gefallen. Vielleicht ist man als Architekt auch ehr skeptisch, ob sich die Welt mit großen regionalplanerischen Entwürfen heute noch positiv verändern lässt oder ob durch diese megalomane Art der Planung, von oben herab, nicht mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird. Diese Erfahrung macht man konkret mit fast jedem Bebauungsplan, der vor Jahrzehnten aufgestellt, heute schon nicht mehr der Lebenswirklichkeit der Betroffenen entspricht. Die Welt verändert sich schneller als die großen Pläne. Alexander und seine Mitstreiter entwickeln hier Theorien über die Größe und Verteilung von Städten, über die Verzahnung von Stadt und Land, ebenso wie eine Art der Stadt-Typologie. Die nächst kleinere Einheit der Betrachtung ist dann das Quartier in seiner Abgrenzung zu anderen und in seiner inneren Durchmischung. Es werden verschiedene Netzwerke der Infrastruktur und deren sinnvolle Verteilung betrachtet – „Web of Public Transport“, „Network of Learning“ und „Web of Shopping“. Die Stadt wird hier als Ergebnis sich überlagernder Geflechte gedacht. Sicher kein falscher Gedanke. Was vielleicht fehlt ist diese Geflechte als wandelbar und veränderlich fragil zu erkennen, etwa analog zur diachronen Veränderung einer Sprache. Ab dieser Stufe etwa beschreiben die essayistisch dargestellten Muster unsere Lebenswirklichkeit. Ein paar interessante Muster möchte ich daher herausgreifen. Einmal Muster Nr. 21 „Four-Story Limit”. Wie der Name verrät, geht es um die Begrenzung der innerstädtischen Gebäudehöhe auf vier Geschosse. Scheinbar belegen psychologische Studien aus den 60er und 70er Jahren, dass die geistige Gesundheit der Bewohner mit zunehmender Höhe der Gebäude abnimmt. Was Alexander mit diesem Muster anstrebt, ist eine hohe innerstädtische Verdichtung bei gleichzeitiger Wahrung des menschlichen Maßstabs. Muster 24 beschreibt den Bezug von Siedlungen zu heiligen Stätten: „People cannot maintain their spiritual roots and their connections to the past if the physical world they live in does not also sustain these roots.” (Seite 132) Ein interessanter Gedanke in unserer zunehmend hedonistisch-agnostischen Welt. Muster 25, irgendwie für die Autoren auf gleicher Stufe angesiedelt, formuliert die Bedeutung des Bezugs zum Wasser für eine Gesellschaft. Im Großen und Ganzen sollen die Muster alle Aspekte des Lebens in einer Stadt abdecken bis hin zum Kreislauf von Geburt, Leben und Tod (Muster 26: „Life Circle“). Deswegen beschäftigt sich Alexander in Muster Nr. 70 sogar mit der Anordnung und Verteilung von Friedhöfen im Stadtgrundriss. Städtebauliche Muster sind Teil des Kreislaufs von Leben und Tot und als solche sollten sie in unsren Lebensvollzug eingebettet sein, beziehungsweise umgekehrt: der Vollzug unseres Lebens geschieht immer in architektonischen Umgebungen und wird durch deren Muster geprägt. Man kann also sagen, dass Alexander hier einen ganzheitlichen Anspruch vertritt, was unser Wohnen und damit unser Leben betrifft. Gruppe 12 (Muster Nr. 75-79) der ersten Abteilung beschäftigt sich dann mit verschiedenen Haus-Typen. Nicht im Sinne einer in Plangrafiken ausformulierten Typologie verschiedener Grundrisse, sondern vielmehr als aufs Grundsätzliche bezogene Betrachtung verschiedener, notwendiger Bereiche, je nach Lebenssituation der Bewohner. Dieser Abschnitt geht in der Tat so weit, dass er politische Forderungen formuliert: indem Alexander fordert Spekulation mit und Vermietung von Wohneigentum zu verbieten. Wohnen hat für Alexander etwas mit Kontrolle über das eigene Umfeld zu tun. Diese Kontrolle ist für ihn wiederum eine wesentliche Voraussetzung für psychische Gesundheit. Es wird an dieser Stelle schon klar, dass es in Alexanders Schrift um die grundlegende ethische Frage nach dem „guten Leben“ geht, das heißt, was kann die Architektur zu diesem „guten Leben“ beitragen?
Die zweite Abteilung beschäftigt sich, wie gesagt, mit konkreten Bauwerken, Baugruppen bis hin zu einzelnen Bauteilkonstellationen. Diesem Teil ist wiederum eine Einleitung vorangestellt, in der detailliert beschrieben wird, wie sich Alexander die Anwendung seiner hier gegebenen Muster denkt. Diese „Gebrauchsanweisung“ klingt etwas naiv. Besonders die strikte Reihung der in Sequenz geschalteten „Muster“ entspricht nicht dem iterativen Entwurfsprozess, wie wir ihn kennen. Trotzdem muss man zugestehen, dass einige der von Alexander et aliter beschriebenen Muster durchaus etwas mit architektonischen Qualitäten zu tun haben. Da ist zum Beispiel das Muster Nr. 104 „Site Repair“, das einen weiteren ethischen Grundsatz formuliert: „Buildings must always be built on those parts of the land which are in the worst condition, not the best.“ Damit will Alexander erstens sagen, dass durch das Bauen keine schönen Flecken Erde verunstaltet werden sollen und dass zweitens die Welt durch das Gebaute nachher eine bessere sein sollte, als vor der Baumaßnahme. Undenkbar in Zeiten eines völlig kommerzialisierten Bauwahnsinns! Ein weiteres Muster, Nr. 106, geht in eine ähnliche Richtung und fordert „Positive Outdoor Space“. Gemeint ist damit eine Spielart des Verhältnisses von voll und leer, dass die „leeren“ Stellen der Stadt nicht als Restflächen begreift, sondern als positiv zu gestaltende Räume mit ihren eigenen Bezügen und Gesetzmäßigkeiten. Dieses Muster verbindet sich mit anderen, die den auf ein Wohnhaus bezogenen Außenraum betreffen, es gibt auch etwas, dass man als die „Hierarchy of open Space“ bezeichnen kann (Nr. 114). Insbesondere betrifft dies das Thema Übergang – „Entrance Transition“ – Nr. 112. Der Übergang von innen nach außen und umgekehrt der Bezug vom Innen zum Außen sind so basale Themen der Architektur, dass sie in jedem Gebäude eine entscheidende Rolle spielen. Offensichtlich wird das bei ambivalenten Räumen, die sich weder eindeutig der Architektur als einem Innen noch der Stadt, als dem dazugehörigen Außen zuordnen lassen; Arkaden beispielsweise (Nr. 119) oder „Building Edge (Nr. 160). Mit einem anderen Muster (Nr. 127) versucht Alexander Grade der Intimität innerhalb einer Wohnung zu beschreiben, also die Bewegung von öffentlichen über halböffentliche hin zu strikt privaten Bereichen. Ein Spannungsverhältnis, dass historisch und kulturell sicher ganz unterschiedlich zu bewerten ist, dass aber nichtsdestotrotz in jedem Wohnbereich eine Rolle spielt. Eine weitere Ausformulierung des Verhältnisses von Innen und Außen sind die Blickbeziehungen in verschiedene Richtungen, das architektonische Thema von Ausblick und Einblick entfaltet sich hier und Alexander streift dieses Thema mehrfach, zum Beispiel im Muster Nr. 134, „Zen View“. Ein weiteres Moment des Spannungsverhältnisses von Voll und Leer ist die Gestaltung der „Leere“ durch massive Elemente. So prägen zum Beispiel die Gebäudeformen den innerstädtischen Freiraum, die Straße, der Platz, die Gasse werden zum Aufenthaltsraum. Muster Nr. 121 „Path Shape“ versucht dem Rechnung zu tragen.
Nicht wenige dieser Muster beschäftigen sich mit dem Licht, beziehungsweise mit dem Verhältnis von Licht und Dunkel zum Beispiel Nr.107, „Wings of Light“ oder Nr. 128 „Indoor Sunlight“, als Streit von Licht und Dunkel im Muster Nr. 135, „Tapestry of Light and Dark“, das die Bedeutung unterschiedlicher Lichtintensitäten und unterschiedlicher Lichtqualitäten herausstellt. Nichts ist tödlicher für den Raum als eine gleichförmige Ausleuchtung! Dieser Einsicht folgen auch die Muster Nr. 159, „Light on two Sides of every Room”, Nr. 161, “Sunny Place” und Nr. 180, “Window Place”. Natürliches Licht ist eine wesentliche Bedingung menschlichen Lebens. Die Annahme, man könne dieses Licht durch Kunstlicht ersetzen, ist absurd! Wir sind, wie Alexander sich ausdrückt, „heliotrope Wesen“. Wir richten uns nach der Sonne aus, sind auf sie bezogen. Dasselbe gilt für die Räume, die wir uns selbst schaffen. Dies gilt in extenso für das ganze Gebäude, das als Ganzes unser Verhältnis zum Licht widerspiegelt (Muster Nr. 161, „North Face“). Wir kennen das unter dem Schlagwort Gebäudeorientierung. Eine Form des natürlichen Lichts ist das Feuer, von dem Alexander lapidar sagt „There is no substitute for fire.“ (Seite 839) Er bezieht sich dabei auf die psychologischen Beobachtungen Gaston Bachelards in seiner Schrift „La Psychoanalyse du Feu“. Unsere Beziehung zum Feuer ist ebenso eine archaische Konstante des menschlichen Daseins, wie unsere Bezug zum Licht. Eines der letzten beschriebenen Muster in diesem Band, Nr. 252, „Pools of Light“ kehrt wieder zum Thema Licht zurück. Diesmal ist allerdings tatsächlich das künstliche Licht gemeint, das dennoch, analog zum natürlichen Licht, auf keinen Fall gleichmäßig verteilt sein sollte: „Uniform illumination – the sweetheart of the lighting engineers – serves no useful purpose whatsoever. In fact, it destroys the social nature of space, and makes people feel disoriented and unbounded.”
Weitere große Aufmerksamkeit widmet Alexander dem Thema Raumproportionen. Er spricht sich unter anderem für unterschiedliche Raumhöhen aus, je nach Nutzung und gewünschter Atmosphäre der Räume. „In some fashion, low ceilings make for intimacy, high ceilings for formality.” (Muster Nr. 190, “Ceiling Height Variety”, Seite 877). Gleich das folgende Muster beschäftigt sich mit der Raumform als solcher – Muster 191, „The Shape of indoor Space“: „The perfectly crystalline squares and rectangles of ultra-modern architecture make no special sense in human or structural terms. They only express the rigid desires and fantasies which people have when they get too preoccupied with systems and the means of their production.” (Seite 883) Das will nicht heißen, dass Alexander der Anthroposophie das Wort redet. Für ihn hat lediglich die Anmutung der Räume einen höheren Stellenwert als die möglichst rationale Rasterung der Bauteile. Zum Raumgefühl tragen nicht nur die Längenverhältnisse in den drei Dimensionen und die Gestalt der begrenzenden Bauteile bei, sondern auch die Form der Bewegung, die ein Raum suggeriert oder durch die Anordnung seiner Elemente zulässt. Die Bewegung ist entweder im Einklang mit dem Gefühl, dass Form und Proportion vermitteln, oder sie läuft diesem zuwider. Ein Beispiel dafür ist die Lage der Türen in Bezug auf den Grundriss einzelner Räume – Muster Nr. 196, „Corner Doors“. Ein weiteres Moment der Anmutungsqualität von Räumen ergibt sich aus der „Dimension“ beziehungsweise der Plastizität ihrer Hülle, die Alexander im folgenden Muster Nr. 197, „Thick Walls“ anspricht.
Zum dritten Teil – Construction – will ich gar nicht allzu viel sagen, da die hier gegebenen Beispiele zum Teil ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen und zum Teil zu sehr auf Alexanders persönlichen Architekturstil zugeschnitten sind. Offensichtlich ist hier die Ablehnung industrieller Bauweisen. „Our intention in this section has been to provide an alternative to the technocratic and rigid ways of building that have become the legacy of the machine age and modern architecture.” (Seite 936) Alexander verfolgt also eine eher handwerkliche Herangehensweise an die Architektur. Man könnte ihm daher einen gewissen Hang zur Nostalgie oder eine gewisse rückwärtsgewandte Romantik vorwerfen. Das ist als eine Reaktion auf den teilweise öden Funktionalismus der Nachkriegsmoderne verstehen. Das zeigt sich gleich im ersten Muster dieses dritten Teils, Nr. 205, „Structure Follows Social Spaces“ und nicht etwa der Funktion. Der „Soziale Raum“ und nicht der „funktionale“ steht hier im Mittelpunkt. „No building ever feels right to the people in it unless the physical spaces (defined by columns, walls, and ceilings) are congruent with the social spaces (defined by activities and human groups). Beziehungen, Verhältnisse, Aktivitäten, Relationen und Bewegungen machen den Raum, Funktionen sind nur ein Teil davon. Alexander schreibt daher weiter: „First: the spaces called for by the patterns with social and psychological needs are critical. If the spaces are not right, the needs are not met and problems are not solved. Since these spaces are so critical, it stands to reason that they must be felt as real spaces not flimsy or haphazardly partitioned spaces, which only pay lip-service to the needs of people.” (Seite 944f) Diesen – sagen wir einmal atmosphärischen – Aspekt der Raumgestaltung greift die 6. Gruppe des dritten Teils wieder auf, die sich mit der materiellen Ausgestaltung der Oberflächen beschäftigt. So werden hier je nach Zonierung des Raums unterschiedliche Fußbodenoberflächen vorgeschlagen, Muster Nr. 233, „Floor Surface“. Es wird auch auf die Haptik der inneren Wandoberflächen abgehoben, Muster Nr. 235, „Soft inside Walls“. Bezogen auf die Öffnungen und damit auf die Qualität des natürlichen Lichts formulieren Muster Nr. 239, „Filtered Light“ und Muster Nr. 239, „Small Panes“ eine notwendige Betonung der Grenze zwischen Innen und Außen, als Bedingung für das Gefühl der Geborgenheit in einem Raum. Dazu Alexander: „Modern architecture and buildings have deliberately tried to make windows less like windows and more as though there was nothing between you and the outdoors. Yet this entirely contradicts the nature of windows. It is the function of windows to offer a view and provide a relationship to the outside, true. But this does not mean, that they should not at the same time, like the walls and roof, give you a sense of protection and shelter from the outside.” (Seite 1110)
Wir sehen also, dass sich Christopher Alexander auf seine Weise mit einigen der grundlegendsten Fragen der architektonischen Gestaltung auseinandersetzt. Viele Seiner Muster, beschäftigen archetypischen Elementen und Konstellationen des der architektonischen Schöpfung. Besonders interessant sind die zum Teil in Briefmarkengröße gegebenen Skizzen und Schemata, die den Text immer begleiten. Es gibt also immer eine visuelle Unterstützung der textlich gegebenen Thesen, die in vielen Fällen sehr zur Plausibilität des gesagten beiträgt. Allein hierin liegt ein unerschöpflicher Schatz an Inspirationen. Es wird dadurch ein wenig klarer, was Alexander eigentlich mit seinem Begriff „Pattern“ – Muster -meint. Architektonische Muster sind – in verschiedenen Maßstäben betrachtet – Konstellationen von Bauteilen, Bauten oder Baugruppen bis hin zu Quartieren oder Siedlungen. Viele dieser Muster erscheinen nur, wenn man von oben auf die Dinge herabschaut, also aus der Perspektive des Planers. Die Erkenntnis des Musters erfordert eine Gesamtübersicht, sie erfordert einen Vergleich. In unserem alltäglichen Leben haben wir diese Übersicht selten, was die städtebauliche Dimension anbelangt allenfalls in der Perspektive aus dem Flugzeug heraus. Dadurch wird klar, dass Alexanders trotz aller Detailverliebtheit und konkreter Beispiele in Bild und Skizze. Es ist eine planerische Sicht auf die Dinge, auch wenn Alexander – das darf man zugestehen – in seinen Erläuterungen immer wieder in die Perspektive des Bewohners wechselt. Das muss man sich bewusst machen. Die Erkenntnis verschiedener baulicher Muster ist etwas anderes als deren Anwendung.
Man sollte dieses Buch als ein Nachschlagewerk beziehungsweise als Inspirationsquelle verstehen. Viele der hier verhandelten Muster dienen als Anregung im eigenen Entwurfsprozess. Sie müssen allerdings an die zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten der aktuellen Situation angepasst werden. „A Pattern Language“ ist weniger als Lehrbuch oder als konkrete Handlungsanleitung geeignet. Die hier gegebenen Beispiele zeigen verschiedentlich allzu sehr den Zeitgeist eines vernakularen Stils der 70er Jahre, der wohlmöglich immer noch die suburbanen Landschaften der USA prägt. Gemeint ist der anglo-amerikanische Landhausstil. Viele dieser Muster sind also in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts schon etwas in die Jahre gekommen. Die Zeiten ändern sich und jetzt an der Schwelle der ökologischen Katastrophe und der nächsten Energiekrise, sieht man vieles mit anderen Augen, vor allem, was das Thema Mobilität betrifft. Einige der Muster wirken dagegen erfrischend aktuell. Vielleicht kommt es auf jedes einzelne dieser Muster gar nicht so sehr an. Wenn ich das als Architekt lese, stelle ich mir die Frage, ob nicht jeder, der praktisch arbeitet, im Laufe seines Schaffens solche Muster entwickelt. Jeder verwendet gerne Bauteilkonstellationen, Formenspiele, städtebauliche Herangehensweisen, die sich in vergangenen Projekten bereits bewährt haben. So gesehen entwickelt jeder Architekt seine eigene Mustersprache. Diese Mustersprache ist näherungsweise das, was man bei verschiedenen bekannteren Architekten als deren Stil diagnostiziert. Das sind wiederkehrende Konstellationen, an denen man den Meister untrüglich wiedererkennt. Leider gerät diese Wiedererkennbarkeit bei den meisten Großen zum Manierismus.




