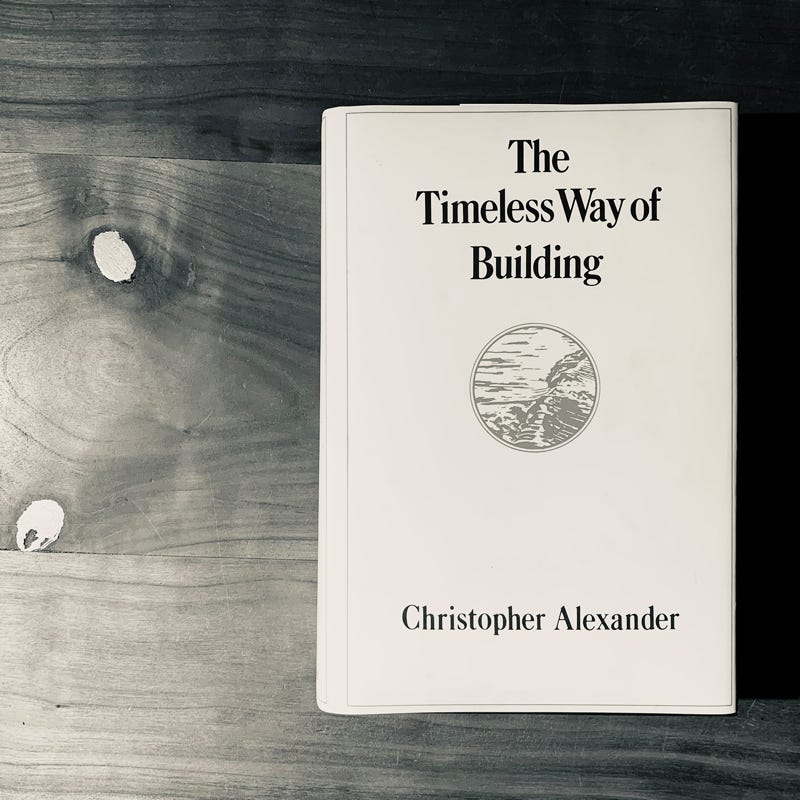
In „The Timeless Way of Building“ sucht Alexander – wie der Titel schon verrät – nach dem zeitlosen Wesen der Architektur, beziehungsweise nach zeitlosen „Mustern“ des Architekturschaffens, was aus seiner Sicht nicht unbedingt dasselbe ist.
„The fact is that the difference between a good building and a bad building, between a good town and a bad town, is an objective matter. It is the difference between health and sickness, wholeness and dividedness, self-maintenance and self-destruction. In a world which is healthy, whole, alive, and self-maintaining, people themselves can be alive and self-creating. In a world which is unwhole and self-destroying, people cannot be alive, they will inevitably themselves be self-destroying, and miserable. But it is easy to understand why people believe so firmly that there is no single, solid basis for the difference between good building and bad. It happens because the single central quality which makes the difference cannot be names.” (Seite 25)
Die Suche nach den zeitlosen Mustern des Architekturgestaltens ist gleichermaßen die Suche nach einem Moment der Stimmigkeit“ eines architektonischen Werks oder einer Stadtplanung, eines Ensembles oder eines architektonischen Details, der Stimmigkeit einer Inneneinrichtung et cetera. Alexander müsste demnach zwischen „guten“ und „schlechten“ Mustern unterscheiden, was er in Bezug auf die Lebendigkeit der Muster indirekt auch tut. Grundsätzlich ist für ihn „pattern“ dennoch ein positiv besetzter Begriff.
Was genau die Stimmigkeit eines Musters ausmacht, kann gar nicht präzise mit Worten erfasst werden. Sie lässt sich nicht nach klar definierten Regeln erzeugen. Es ist eine Stimmigkeit des Zusammenspiels vieler, fast unendlicher Faktoren. Mit den Worten Alexanders handelt es sich um „The Quality without a Name“. Diese Stimmigkeit kann eher mit unserem Gespür für unsere Umwelt erfasst werden als mit dem Intellekt. Dennoch ist es eine Qualität der Umgebung, die jedem auf seine Weise direkt zugänglich ist. Alexander versucht trotzdem „The Quality without a Name” mit sieben Begriffen zu umschreiben. Diese sind:
1. „alive“ – lebendig 2. „whole“ – ganz, vollständig, komplett 3. „comfortable“ – behaglich, bequem, passend 4. „free“ – frei, offen 5. „exact“ – genau 6. „egoless“ – selbstlos 7. „eternal“ – ewig, immerwährend
Es wird klar, dass keines dieser Worte die „Qualität ohne Namen“ allein beschreiben kann, wobei dem Begriff der „Lebendigkeit“ sicher eine besondere Bedeutung zukommt. Seltsamerweise werden die anderen Begriffe – abgesehen von der Lebendigkeit eben – nicht mehr in derselben Tiefe aufgegriffen, obwohl doch Ganzheit, Freiheit, Selbstlosigkeit und Ewigkeit dies sicher verdient hätten. Alle diese Begriffe spannen ein Feld auf, indem sich die Stimmigkeit der „Qualität ohne Namen“ entfaltet. Die Begriffe selbst beschreiben die Gegensätze und Spannungen, die diese Stimmigkeit ausmachen. Sie haben etwas mit unserem Sich-Fühlen zu tun:
„We need only ask ourselves which places – which towns, which buildings, which rooms, have made us feel like this – which of them have the breach of sudden passion in them, which whispers to us, and lets us recall those moments when we were ourselves.” (Seite 53)
Jeder kennt dieses Gefühl, dass sich eine Situation, eine räumliche Umgebung einfach richtig anfühlt. Daran besteht kein Zweifel. Das gegenteilige Gefühl ist uns ebenso vertraut: Man hat in einer Situation das unbestimmte Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Solche Situationen sind dabei keineswegs statisch. Umgebung, Atmosphäre und Geschehen sind situativ untrennbar miteinander verwoben.
„To understand this clearly, we must first recognize that what a town or building is, is governed, above all, by what is happening there. […] Activities; events; forces; situations; lightning strikes; fish die; water flows; lovers quarrel; a cake burns; cats chase each other; a hummingbird sits outside my window; friends come by; my car breaks down; lovers’ reunion; children born; grandparents go broke. … […] Those of us who are concerned with building tend to forget too easily that all the life and soul of a place, all of our experiences there, depend not simply on the physical environment, but on the patterns of events which we experience there.” (Seite 62)
Die Muster von denen Alexander spricht sind also nicht als reine Formen der gebauten Umwelt zu verstehen, sondern es sind eher Muster im Sinne von „Bewegungsmustern“, wie man sie etwa aus der Zoologie kennt. Bewegungsmuster übertragen verstanden, als Muster von Ereignissen unseres alltäglichen Lebens. „We know, then, that what matters in a building or a town is not its outward shape, its physical geometry alone, but the events that happen there.” (Seite 65)
Der Begriff des „Musters“ hat daher für Alexander auch den Vorteil, dass er kulturelle Aspekte umschreiben kann. Wir sind nicht allein, sondern leben in einer, wie auch immer ausgeprägten Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft prägt wiederum unser Verhalten, gibt uns „Verhaltens-Muster“ vor in die wir uns selbst einschreiben.
„A person can modify his immediate situations. He can move, change his life, and so on. In exceptional cases he can even change them almost wholly. But it is not possible to go beyond the bounds of the collection of events and pattern of events which our culture makes available to us.” (Seite 68f)
Den Verhaltens-Mustern unserer Kultur können wir uns, wenn überhaupt, nur mit Mühe entziehen. Sie sind Teil unseres Seins. Jedes Ereignis unseres Lebens spielt sich vor dem Hintergrund dieser Muster ab, die wir entweder – bewusst oder unbewusst – für uns übernehmen, oder, die wir – aktiv oder versehentlich – durchbrechen. Unser Leben setzt sich aus einer Unzahl solcher Ereignisse zusammen – triviale wie besondere.
Die Ortsbezogenheit dieser Ereignisse liegt auf der Hand: „I cannot imagine any pattern of events without imagining a place where it is happening. I cannot think of sleeping, without imagining myself sleeping somewhere.” (Seite 69) Und eine Seite weiter heißt es: „The action and the space are indivisible. The action is supported by this kind of space. The space supports this kind of action. The two form a unit, a pattern of events in space.” (Seite 70) Mit Ereignis und Handlung tritt aber ein genuin zeitliches Moment in die Architektur. Wenn ihre räumlichen „Muster“ mit – wiederkehrenden – Handlungen verwoben sind, dann entfaltet Architektur nicht allein den Raum, sondern vielmehr einen Zeit-Spiel-Raum. „Muster“ sind demnach nicht allein räumlich zu erklären. Es kommt ihnen vielmehr auch ein zeitlicher Aspekt zu. Dass es sich bei architektonischen Räumen im Grunde um Zeit-Spiel-Räume handelt ist eine fundamentale Einsicht in das Wesen der Architektur.
Stellt sich die Frage nach der inneren und äußeren Ordnung dieser Muster: „Suppose I want to understand the >structure< of something. Just what exactly does it mean?” (Seite 81) Struktur ist demnach das Verhältnis verschiedener Elemente. Je weniger Elemente, desto auffälliger wird das Verhältnis selbst. “The fewer Elements there are, the richer the relationships between them, the more of the picture lies in the >structure< of these relationships” (Seite 81) Dabei sind die Elemente nicht unabhängig, von den Verhältnissen, in denen sie zueinanderstehen:
„When we look closer, we realize that these relationships are not extra, but necessary to the elements, indeed a part of them. […] When we look closer still, we realize that even this view is still not very accurate. For it is not merely true that the relationships are attached to the elements: the fact that the elements themselves are patterns of relationships.” (Seite 88)
Damit will Alexander sagen, dass die Elemente selbst wiederum kleinere, beziehungsweise untergeordnete Muster sind. Das Verhältnis dieser Elemente ist also ein Verhältnis von Verhältnissen und so fort ad Infinitum. Feste Elemente werden so für Alexander zum Mythos. Alles ist Verhältnis.
“And finally, the things which seem like elements dissolve, and leave a fabric of relationships behind, which is the stuff that actually repeats itself, and gives the structure to a building or a town. In short, we may forget about the idea that the building is made up of elements entirely, and recognize instead, the deeper fact that all those so-called elements are only labels for the patterns of relationships which really do repeat.” (Seite 89)
Dieser Punkt ist Alexander so wichtig, dass er ihn zwei Seiten später in Variation ausführlich wiederholt:
“The patterns are not just patterns of relationships, but patterns of relationships among other smaller patterns, which themselves have still other patterns hooking them together – and we see finally, that the world is entirely made of all these interhooking, interlocking, nonmaterial patterns.” (Seite 91)
Dieser infinite Regress hätte Alexander auffallen müssen, hätte er sich ausführlicher mit den sprachphilosophischen Grundlagen seiner Theorie auseinandergesetzt (siehe unten). Es ist gut möglich, dass sich Alexander dieser Tatsache durchaus bewusst ist. In jedem Fall liegt hier, wie bei allen Regressen, philosophisch betrachtet, der Hund begraben und es hilft wenig diese unendliche Ausdifferenzierung in der „Kultur“ verankern zu wollen.
“Neither does a pattern of events >cause< the pattern in the space. The total pattern, space and events together, is an element of people’s culture. It is invented by culture, transmitted by culture, and merely anchored in space.” (Seite 92)
Hier zeigt sich, dass Alexander keinen richtigen Ding-Begriff kennt oder aber jeden Begriff der „Dinglichkeit“ ablehnt. Alles ist Struktur und Verhältnis. Die Behauptung, alles sei Verhältnis und damit alles relativ, entspricht nicht unsere alltägliche Erfahrung, schon gar nicht was unseren Bezug zu unserer architektonischen Umwelt betrifft. Es gibt keine „reinen“ Verhältnisse im alltäglichen Umgang mit der Welt. Es gibt die Dinge verschiedener Ebenen, die mit uns und unseresgleichen zueinander in bestimmten Beziehungen stehen. Alexanders Versuch diese Verhältnisse in sprachlich kodierte, reine Muster zu transformieren muss an dieser Stelle scheitern. Er widerspricht überdies seiner eigenen, handwerklichen Herangehensweise an das Bauen. Entschieden muss ich gegen den Begriff der „Erfindung“ (invention) Stellung beziehen. Kulturen, ihre Muster und die Dinge, an denen sich eine bestimmte Kultur herauskristallisiert, sind keine Erfindungen. Kultur ist etwas, dass sich zwischen Menschen – zwangsläufig kann man sagen – einstellt. Kultur ist darüber hinaus, analog der Sprache, ein transitives Geschehen. Dieses findet seinen Halt an den Dingen, die es hervorbringt, das sind nicht zuletzt Bauten. Von den „institutions of man“ spricht Lois Kahn, den „Setzungen“ des Menschen. Damit meint er vor allem jene Bauten, an denen gesellschaftlich etwas fest gemacht werden kann. Hier manifestieren Sich die „Ideen“ einer Gemeinschaft, werden greifbar. Man merkt schnell, dass hier in Alexanders Überlegungen etwas Entscheidendes fehlt, dass ein wesentliches Moment der Architektur zu Gunsten des „architektonischen Codes“ abgeblendet wird.
So recht will dieser strukturalistische Ansatz auch nicht zu einer anderen Strömung in Alexanders Narrativ passen: dem Moment der Lebendigkeit. „The specific patterns out of which a building or a town is made may be alive or dead. To the extent they are alive, they let our inner forces loose, and set us free; but when they are dead they keep us locked up in inner conflict.” (Seite 101). Der Begriff der Lebendigkeit überlagert sich hier eindeutig mit dem, was wir Stimmigkeit genannt haben. Gemeint ist aber hier nicht die innere Stimmigkeit eines architektonischen Musters, sondern die Stimmigkeit des Verhältnisses zwischen Menschen und Umgebung. Die Frage ist somit: Wie Trägt Architektur zu unserer „Lebendigkeit“ bei? „The fact is, a person is so far formed by his surroundings, that this state of harmony depends entirely on his harmony with his surroundings.” (Seite 106) Lebendigkeit ist also ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Umwelt und ihrem Bewohner. Ein Verhältnis, in dem alle Konflikte zwischen beiden in irgendeiner Form „befriedet“ sind. Man könnte sagen, die „Lebendigkeit“ ist das Gegenstück zur intrinsischen Stimmigkeit der Muster eines Bauwerks oder einer städtebaulichen Planung. Die Lebendigkeit ist die Stimmigkeit des Verhältnisses zwischen Menschen und Architektur oder Stadtraum. Es handelt sich also um eine Stimmigkeit, die sich immer wieder neu einstellen muss, eine „lebendige“ Struktur, wenn man so will.
Hier läge eine mögliche Brücke zum Phänomenfeld der Sprache – Paradigma einer lebendigen Struktur. Es gelingt Alexander aber nicht – das ist der entscheidende Mangel seiner Schrift – seine „pattern language“ in die Tradition verschiedener Probleme der Sprachphilosophie seit Platon einzuordnen. So führen beispielsweise Platons „mittlere“ Dialoge Theaitetos, Sophistes und Politikos die Teilung und Unterteilung von Begriffen, Beginn und Ende der verhandelten Dihairesen (Begriffsteilungen), in jede Richtung ad absurdum. Was Alexanders zwei Ansätze – „top-down“ und „bottom-up“ – aus philosophischer Sicht mehr als fragwürdig erscheinen lässt. Welches ist das erste Muster in der Kette und welches sind die letzten? Wie weit kann man eine Zergliederung in Details treiben? Mit De Saussure stellt sich weiter die Frage nach Anfang und Ende einer Sprache, die ebenfalls ohne Antwort bleiben muss. Sprache wird demnach als Emergenzphänomen ausgewiesen. Mit Wittgenstein würde man dann die Möglichkeit einer privaten, das heißt durch einzelne konstruierte, Muster-Sprachen in Frage stellen. Lebendige Sprachen – Lebendigkeit ist gerade eines von Alexanders Schlagworten zu Beginn seiner Schrift – lassen sich weder generieren noch konstruieren. In gewisser Weise erkennt auch Alexander dies an, wenn er mit Blick auf die Moderne vom „Breakdown of Language“ spricht. Dieser hat für ihn seine Ursache in einer „Entfremdung“ – um hier Marx‘ Begriff aufzugreifen – zwischen dem Bewohner und dem Erbauer von Bauten und Städten. Der Höhepunkt beziehungsweise das Ende dieser Entfremdung ist das „total design“ (Seite 238), dass alles der Planung weniger Spezialisten unterwirft und dabei die Bedürfnisse des Einzelnen zunehmend unterwirft. Die lebendigen Muster einer gelungenen architektonischen Umgebung lassen sich folglich nicht totalitär vorgeben, sondern es ist vielmehr so, dass diese „Muster“ in der Architekturgeschichte vorgefundene Gestalten sind, die sich rückblickend beschreiben und ordnen lassen. Sie sind von sich her, aus dem Wesen der Architektur hervorgegangen. In dieser Hinsicht sind sie als „zeitlos“ anzusehen. In der Tat gereift Alexander immer wieder auf historische Beispiele zurück. Darüber hinaus ist Rudofskys „Architecture Without Architects“, das gerade solche, von sich aus erscheinenden Muster, beschreibt, eine Referenz für Alexander (Siehe Acknowledgments Seite 552). Sein System der „Muster-Sprache“ täte aus meiner Sicht gut daran, sich analytisch auf gegebene Situationen zu beziehen. Das würde sie dem Vorwurf der „Design-Rhetorik“ entziehen und sie zudem konkret nachvollziehbar machen. Auf diese Weise könnte eine „Muster-Sprache“ zu einem dringend gebrauchten Medium zwischen Experten und Laien werden, da sie architektonische Entwürfe vorab mit Händen greifbar macht.
Der grundlegenden Analysen Alexanders zum Moment der Stimmigkeit in allen zeitlosen Werken der Architektur und des Städtebaus – mit oder ohne Planer dahinter – kann ich problemlos folgen. Auch der Feststellung, dass Architektur nicht nur durch statische Formen, sondern vielmehr durch Ereignisse bestimmt ist. Der konkreten Ausformulierung seiner „Muster-Sprache“ und der Behauptung, dass sich diese am Ende selbst überflüssig machen wird, kann ich nicht nachvollziehen.




