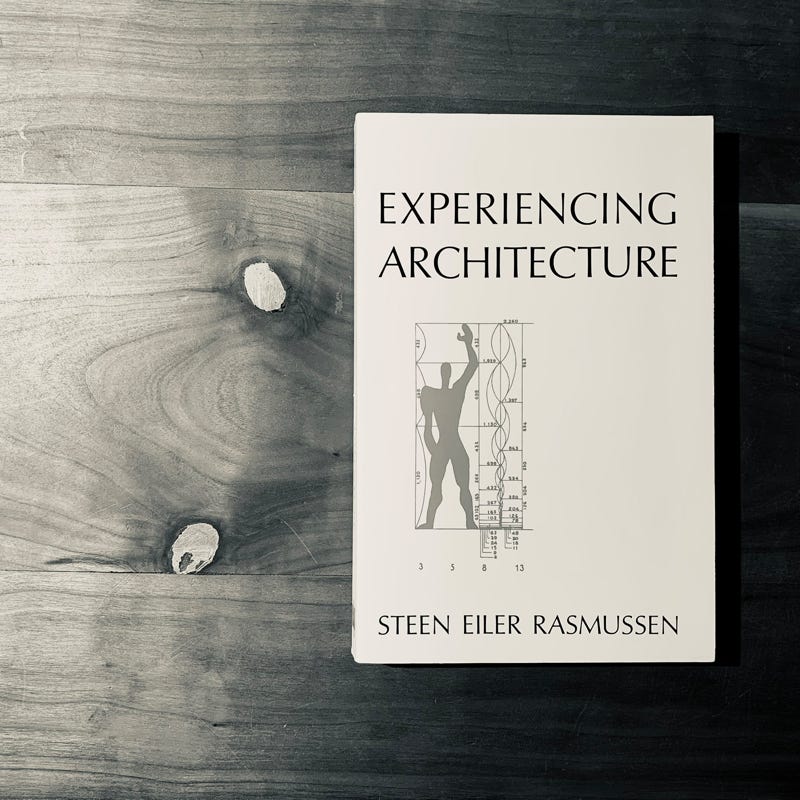
Es handelt sich um einen Grundlagentext der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts. Rasmussen beschäftigt sich als einer der Ersten ausführlich mit dem Architekturerlebnis, dass heißt mit der Wirkung der gebauten Umwelt auf ihre Bewohner. Eine zentrale Frage der Architektur, möchte man meinen.
In zehn Kapiteln untersucht Rasmussen verschiedene Momente dieser Wirkung. Er beginnt mit ein paar grundsätzlichen Beobachtungen. Beispielsweise lässt sich Architektur niemals vollständig darstellen. Sie ist immer mehr, als Pläne und andere Darstellungen von ihr zu sehen geben. Weiter ist Architektur an unser Leben gebunden. Nur indem sie diesem Raum gibt, ist sie wirklich. Wie unser Leben, ist Architektur daher auf die Zukunft gerichtet. Architektur gibt in ihrer Permanenz einer möglichen Zukunft Raum. Dabei ist sie von grundlegenden Gegensätzen geprägt: hart – weich; leicht – schwer; warm – kalt. Diese Wirkungen oder Erscheinungsweisen haben etwas mit ihrer Stofflichkeit zu tun, der Art und Weise, „wie“ etwas gebaut ist. Architektur ist daher immer ein Ganzes, das mehr ist als die bloße Summe seiner Teile. Im zweiten und dritten Kapitel untersucht Rasmussen das Spannungsverhältnis von „Solids and Cavities“, also den Gegensatz von Volumen und Höhlung. In der Architektur haben wir es immer mit massiven Elementen zu tun. Der Streit zwischen voll und leer wird in jedem Bauwerk ausgetragen: „Instead of letting his imagination work with structural forms, with the >solids< of a building, the architect can work with the empty space – the cavity – between the solids, and consider the forming of that space as the real meaning of architecture.” (Seite 46) Das vierte Kapitel widmet Rasmussen dem Aufbau von (Innen-)Räumen durch farbige Flächen. Prominentes Beispiel für eine „flächige“ Auffassung der Architektur ist die Villa Tugendhat von Mies van der Rohe. Zahllose weitere Beispiele lassen sich in der traditionellen japanischen Architektur finden. Architektur wird also nicht nur durch Volumen – voll oder leer – bestimmt, sondern ebenso durch farbige Flächen – genauer gesagt durch deren Verhältnis zueinander. Daher handelt das fünfte Kapitel von den Proportionen im klassischen Sinne. Rasmussen unterzieht hier das Verhältnis architektonischer Proportionen zu den musikalischen Proportionen – Oktave, Terz, Quarte, Quinte etc. – einer kritischen Revision. Der Goldene Schnitt wird diskutiert, klassische Beispiele, wie etwa Andrea Palladio werden kurz besprochen und natürlich „last but not least“ LeCorbusiers Modulor-System. Alles in allem enthält das Kapitel eine kurze Einführung in das Thema Proportion in der Architektur. Das folgende Kapitel widmet sich einer weiteren scheinbaren Gemeinsamkeit zwischen Architektur und Musik: dem Rhythmus. In der Architektur ist das der Wechsel verschiedener sich in bestimmten Abfolgen wiederholender Elemente – etwa Säulen, Pfeiler, Fenster, Nischen, Arkaden, Treppen etc. Auch hier liefert Rasmussen eine kenntnisreiche Analyse verschiedenster historischer Beispiele, unter anderem das „Baker House“ am MIT, Cambridge, Massachusetts von Alvar Aalto. Bis dahin entspricht die Untersuchung in etwa dem klassischen Kanon der Architekturtheorie. Rasmussen bleibt hier aber nicht stehen. In den letzten vier Kapiteln beschreibt er die Phänomenfelder Stofflichkeit, Licht, Farbe und Klang in der Architektur. Damit ist Rasmussen einer der Ersten, die sich mit der Emotionalität der Architektur beschäftigen. Kapitel sieben untersucht die verschiedenen Verarbeitungsweisen der Baustoffe. Die Anmutungen rau – glatt, hart weich, warm – kalt, steril – lebendig werden aufgezeigt. Der grundsätzliche Gegensatz in der Tektonik zwischen einer homogenen Erscheinungsweise des Stoffs und dem Gefüge aus vielen verschiedenen, distinkten Einzelteilen, wird herausgearbeitet. In Kapitel acht untersucht Rasmussen den Zusammenhang von Licht und Stimmung in der Architektur. Sein herausragendes Beispiel ist Corbusiers Kapelle „Notre Dame du Haut“ in Ronchamp, der hier eine ausgiebige Betrachtung gewidmet wird. Kapitel neun kehrt zur Materialität zurück, genauer gesagt zur Farbe, das ist die materielle Erscheinung der Dinge im Licht. Jedes Material hat seine farbigen Eigenschaften. Mit Farben lassen sich, ähnlich wie mit Gerüchen, relativ einfach bestimmte Gefühle erzeugen. Rasmussen weist hier auf den Zusammenhang zwischen Farbwahl und Marketing hin. Im letzten Kapitel reißt Rasmussen dann kurz das Thema der baulichen Akustik an. Wie klingen verschiedene Gebäude? Wie wirft das Gebäude den Schall zurück, den seine Bewohner erzeugen. Dies ist für Rasmussen ein wesentliches Moment der baulichen Atmosphäre und das keinesfalls allein für Bauten, die sich musikalischen Aufführungen widmen, wie Theater und Konzertsäle. Der Klang des Raums hat wesentlichen Einfluss auf seine Stimmung und damit auf die Befindlichkeit des Bewohners.
„Experiencing Architecture“ erweist sich damit als immer noch gültige Einführung in die Geheimnisse der Wirkung architektonischer Räume. Dabei kommt der Autor ohne jedes Spezialisten Gehabe aus und bleibt immer auf Augenhöhe mit seinem Leser. Absolut lesenswert!




