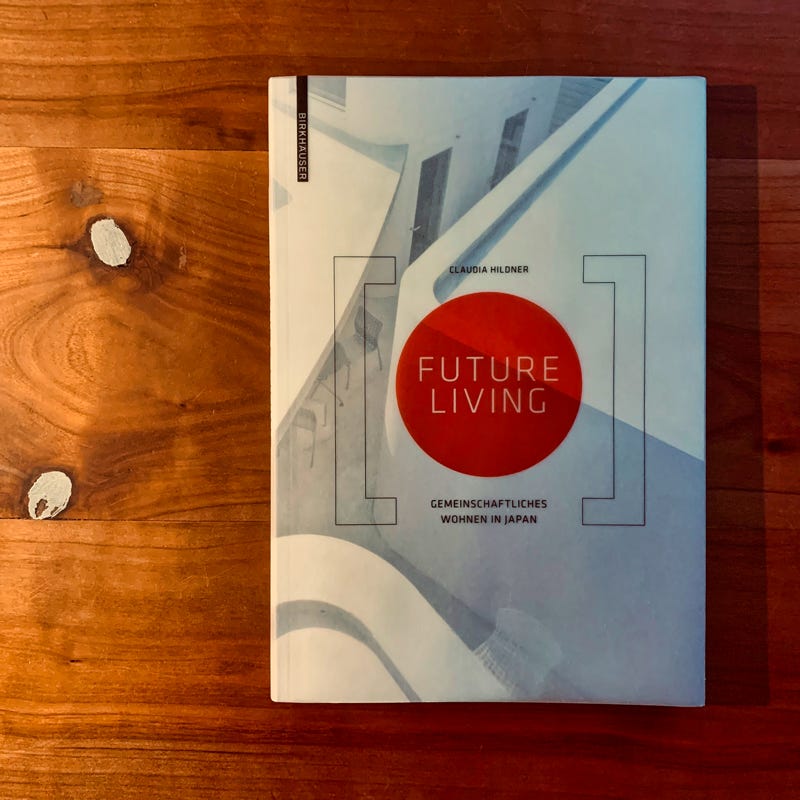
Was sind die wesentlichen Besonderheiten, die japanische Wohnanlagen von europäischen unterscheiden? Da ist zunächst einmal das dreidimensionale Denken. Die meisten der gegebenen Projekte entwickeln die Wohneinheiten nicht allein in der Fläche, das heißt zweidimensional in der Fläche, sondern über innen liegende Erschließungen auch in der dritten Dimension, der Höhe. Ein zweiter wesentlicher Unterschied ist die Kompaktheit der Wohnungen. Alles ist auf ein Minimum reduziert. Flächen werden mit mehreren Funktionen belegt. Die für Europa typische Zergliederung der Grundrisse in einzelne, abschließbare Zimmer fehlt häufig ganz. Es gibt kaum Stauräume, in denen sich der konsumistische Überfluss unserer Wohlstandsgesellschaft anstauen könnte – kein Platz für Gerümpel also. Weiter wird die Privatsphäre eher klein geschrieben. Es scheint ein stärkeres nachbarschaftliches Miteinander möglich zu sein. Daraus resultiert ein offenerer Umgang mit den Spannungsverhältnissen innen – außen, offen – geschlossen, öffentlich – halböffentlich – privat. Dadurch entstehen Höfe, Innenhöfe, überdachte Außenbereiche, außenliegende Erschließungen, Terrassen in Dachterrassen, also eine Vielzahl an mehr oder weniger gemeinschaftlichen Außenbereichen. Neben dem baulichen Volumen wird auch das nicht bebaute Volumen, also das Negativ zur Baumasse, sorgsam mit bedacht. Der Gegensatz von voll und leer spielt eine wesentliche Rolle in fast allen der gezeigten Beispiele. Die Japaner scheinen ein unglaubliches Gespür für Zwischenräume zu haben. Daran liegt es, dass bei aller Kompaktheit der Grundrisse, die Wohnungen selten klaustrophob wirken. Das Ergebnis sind komplexe Raumstrukturen, die ein hohes Maß der gestalterischen Vorstellungskraft erfordern und bei den ausführenden Handwerkern eine gewisse Meisterschaft voraussetzen. In Deutschland würde jeder Investor schreiend davonlaufen, wenn er mit derart komplexen Entwürfen konfrontiert würde. In Japan hat man da anscheinend deutlich mehr Mut.
Der Sammelband zeigt so tatsächlich, wie in der Zukunft innerstädtisches Zusammenleben mit sehr hoher räumlicher Qualität gelingen kann. Einzig der energetisch/ökologische Aspekt scheint bei manchen der Bauten eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Der vorliegende Band ist ein Buch, mit dem man als Architekt wirklich etwas anfangen kann – in der Tat eine Seltenheit. Auswahl und Darstellung der Beispiele sind sehr gut und auf das Wesentliche reduziert.




