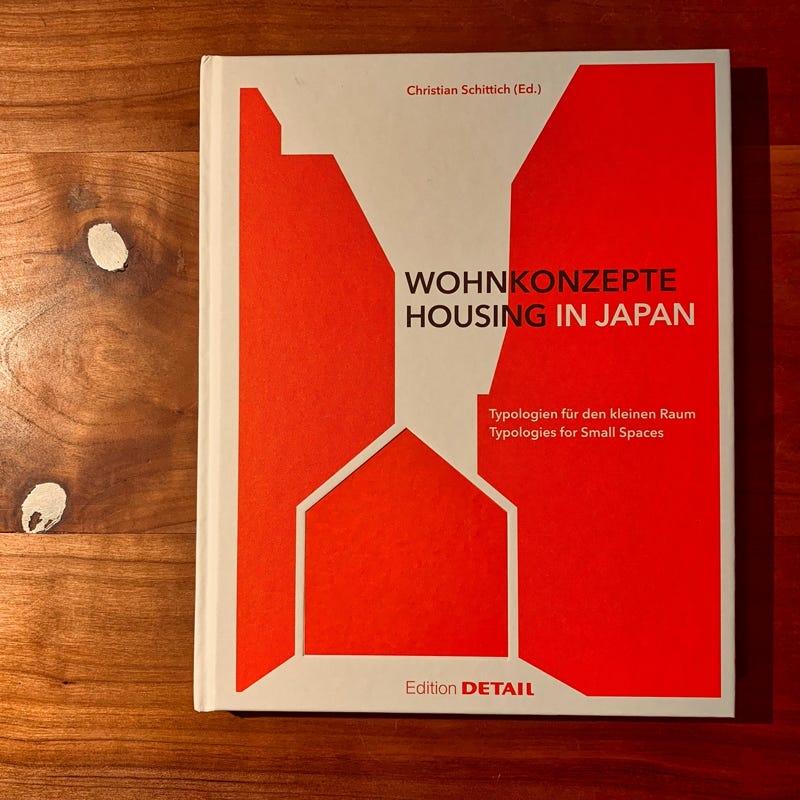
Zum Text: Ich weiß, ich beginne mich zu wiederholen, aber - wie immer - kann man über die Qualität der intellektuellen Auseinandersetzung, die sich in den begleitenden Texten niederschlägt, geteilter Meinung sein. Ich frage mich immer wieder, warum man sich selbst und dem Leser das überhaupt antut. Eine Kostprobe gefällig? – In Hannes Rösslers Beitrag werden tatsächlich Sätze wie dieser formuliert: „Sie [Kazuyo Sejima] verleiht ihren Werken seit ihren frühesten Anfängen eine merkwürdig mädchenhafte, geradezu ornamentale Leichtigkeit […].“ Man mag über Sejima und SANAA denken, wie man will, aber wie kann man im 21. Jahrhundert über eine der bedeutendsten zeitgenössischen Architektinnen so schreiben? Überhaupt wie kann man diese drei Adjektive in einem Satz zusammenbringen und dann auch noch denken, dass sie etwas Erhellendes über die Architektur von SANAA aussagen? Gibt es heutzutage kein Lektorat mehr? Dem hätte doch jemand ordentlich auf die Finger hauen müssen! Warum also schreibt man so etwas? Doch wohl kaum, um böse Philosophen zu amüsieren? Mir scheint hier wird ein pathologischer Narzissmus befriedigt. Der Text von Tao Baerlocher hat mit der präsentierten Auswahl an japanischen Wohnbauten wenig bis gar nichts zu tun. Die Auswahl beschränkt sich, mit einigen wenigen Ausnahmen, auf Einfamilienhäuser. Selbst die besprochenen Mehrfamilienhäuser, etwa von Go Hasegawa, zeichnen sich durch ihren konzentrierten Minimalismus aus. Baerlochers Text beschäftigt sich dagegen mit großen japanischen Wohnbauprojekten. Es scheint sich dabei um die Wiedergabe einer Seminararbeit zu handeln. Entsprechend tiefgründig ist der Text. Lediglich Christian Schittichs Einführung in die Entwicklung des japanischen Wohnungsbaus seit dem 2. Weltkrieg verdient Beachtung. Hier wird zumindest die Grundlage für ein Verständnis des Status Quo im japanischen Städtebau gelegt – was den Großraum Tokyo betrifft. Mehr aber auch nicht. Man versteht in etwa, warum die Grundstücke der meisten betrachteten Werke derart extreme städtebauliche Konstellationen aufweisen und warum die Dauerhaftigkeit der Bauten eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Zur Darstellung: Leider muss ich auch feststellen, dass die gegebenen Grafiken zum Teil schlecht aufgearbeitet sind. Schnitte sind falsch bezeichnet (Seite 50f), Treppenlaufrichtungen falsch angegeben (Seite 51, Seite 61), Vordergrund und Hintergrund werden nicht beachtet (Seite 55), die Beschriftung der Plänchen lässt zu wünschen übrig (Seite 74, „3 Schlafzen“ [sic!]. Die Kurzbeschreibungen der Projekte sind entsprechend – transparent wird mit transluzent verwechselt (Seite 115). Wenigstens die eigene Begrifflichkeit sollte ein Architekt beherrschen. Insgesamt ein editorisches und redaktionelles Desaster! Man kann nur hoffen, dass die Protagonisten in ihren architektonischen Werken etwas sorgfältiger vorgehen.
Zur Sache: Gemeinsam ist fast allen der gegebenen Beispiele, dass sie auf engstem innerstädtischem Raum entstehen. Die Grundstücke sind zum Teil deutlich kleiner als 100m². Der Sammelband kann so als Beitrag zum Thema Nachverdichtung verstanden werden. Bei vielen der gezeigten Beispiele handelt es sich um leichte Konstruktionen. Dauerhaftigkeit ist, wie gesagt, von sekundärem Belang. Selbst dort, wo Massivbauweise zum Einsatz kommt, sind die Wandstärken, im Vergleich zudem, was man in Deutschland erwarten würde, deutlich reduziert. Das Thema Wärmedämmung wird in Japan offensichtlich viel laxer gehandhabt als in Europa. Die Hülle gewinnt daher bei vielen Gebäuden eher einen zelthaften Charakter. Das Thema Wand tritt so gut wie nie in Erscheinung. Funktionen, wie Bäder Abstellbereiche, Waschmaschinen und sogar Schlafbereiche werden oft auf ein Minimum reduziert und zum Teil in schrankartige Einbauten verbannt. Klassische Zimmer, wie sie in unserer europäischen Vorstellung zementiert sind, gibt es bei den meisten hier gezeigten Entwürfen nicht. Wenn einzelne Bereiche abgeteilt werden, dann entweder durch leichte, scheinbar verschiebliche Einbauten. Es geht in den meisten Projekten um eine Verteilung verschiedener unterschiedlich bespielbarer Flächen im Raum – Zonierung statt Kompartimentierung. Es handelt sich um Schichtungen verschiedener multifunktionaler Ebenen im vertikalen Raum und weniger um zweidimensionale Grundrisse, die irgendwie übereinandergestapelt werden, wie das im deutschen Einfamilienhaus auf der grünen Wiese Standard ist. Das Moment Offenheit und gleichzeitig der Leere spielt in den allermeisten gezeigten Beispielen eine herausragende Rolle. Daher lassen sich die Konstruktionen hier in der Regel viel besser aus den Schnitten, als aus den Grundrissen verstehen.
Da diese Bauten sehr viel „leeren“ Raum enthalten, ist die Wohnfläche in den meisten Fällen deutlich geringer als in Deutschland. Wir sprechen hier von Wohnflächen deutlich unter 100m² auf denen z. T. vier bis fünf Personen leben. Überhaupt scheint „Leere“ ein Thema der japanischen Architektur zu sein. Es geht um Reduktion auf das Wesentliche, einen positiven Minimalismus. Was braucht ein Haus und was braucht es nicht? Themen wie das grundlegende Gegensatzpaar von Enge und Weite spielen so eine entscheidende Rolle, für das gestalterische Gelingen der Raumentwürfe. Was lässt sich komprimieren, was braucht Raum. Wie lassen sich Flächen mit multiplen Nutzungen belegen? Wie sind interne Erschließungen möglichst minimal zu organisieren? Wie vermeidet man trotz offensichtlicher Beschränkungen das Gefühl von Enge? Wie lassen sich Privatheit und Außenbezug in einer hochverdichteten Bausituation miteinander in Einklang bringen? Auf diese Fragen und einige mehr, haben japanische Architekten vielfältige Antworten entwickelt. Aus diesen ließe sich so etwas wie ein „Zeitgeist“ des zeitgenössischen japanischen Wohnungsbaus destillieren, da sich die angebotenen Lösungen auf die eine oder andere Weise recht ähnlich sind.
Die meisten hier dargestellten Projekte zeigen, wie man trotz sehr beengter Verhältnisse großzügige und gleichzeitig gut funktionierende Wohnräume gestalten kann. Also bitte nicht falsch verstehen: Ich mag dieses Bändchen! Zeigt es doch, was auch in Deutschland möglich wäre, wenn man sich ein wenig anstrengen würde, wenn die Architekten experimentierfreudiger und die Bauherren etwas entspannter wären und die Bürokraten nicht mehr allein das Sagen hätten in diesem Land. Insofern lese ich dieses Buch als Aufforderung zu einem Umdenken in der deutschen Bautätigkeit. Das Land braucht zur Bewältigung der aktuellen Wohnraumkrise keine neuen bebaubaren Flächen und schon gar keine neuen Großprojekte. Es würde vielmehr genügen, wenn bestehende Stadträume konsequent und mit etwas mehr Fantasie genutzt würden. Das können wir von den Japanern auf jeden Fall lernen.




