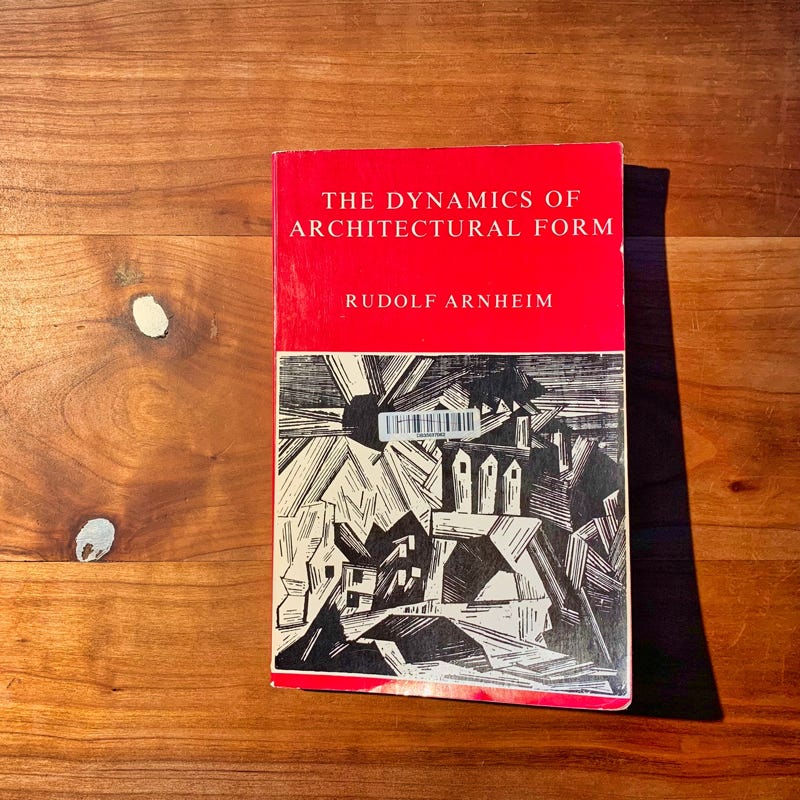
Wie der Titel verrät, handelt es sich um eine Darstellung, die sich auf den formalen Aspekt architektonischer Schöpfungen beschränkt. Andere wesentliche Themen der Architektur – Materialität oder Licht etwa – werden, wenn, dann nur am Rande in die Betrachtungen mit einbezogen. Die Schrift gliedert sich in acht Kapitel mit verschiedenen Unterpunkten.
Ausgehend von den „Elements of Space“, beschreibt Arnheim seinen Begriff des Raums folgendermaßen: „It conceives of space as a self-contained entity, infinite or finite, an empty vehicle, ready and having the capacity to be filled with things. Consciously or not, people derive this notion of space form the world as they see it, and unless they are psychologists, artists, or architects, they are unlikely ever to be confronted with the challenge of questioning it.” (Seite 9) Dieser Frei-Raum wird durch Dinge aufgespannt. Zu diesen gehören unweigerlich auch Architektur-Dinge, sprich Bauwerke. Woraus sich zwangsläufig der Gegensatz voll und leer beziehungsweise frei und besetzt ergibt, der unsere räumliche Erfahrung maßgeblich bestimmt. Die Gestalt der Dinge steht in einer Wechselbeziehung zur Gestalt des Raums, wobei mal die eine, mal die andere die Oberhand behält. Es ergeben sich Nähe und Ferne, das Spiel von Anziehung und Abstoßung, der Gegensatz von konvexen und konkaven Formen, ebenso wie emotionale Gehalte, wie etwa bedrückend oder gemütlich – kurz eine Dynamik der Kräfte, die den Raum bestimmen – ein Kraftfeld. Unsere räumliche Umwelt und damit die auch unsere gebaute Umwelt besteht aus einem Feld gegensätzlicher Spannungsmomente. Zwei davon untersucht Arnheim in Kapitel 2 – „Vertical and Horizontal“ – und Kapitel 3 – „Solids and Hollows“. Auf Grund der Tatsache, dass wir uns immer unter dem Einfluss der Gravitation bewegen und daher einen akuten Sinn für Gleichgewicht haben, hat die Vertikale eine andere Bedeutung für uns. Nimmt man hinzu, dass wir eigentlich von Natur aus nicht fliegen können, dann wird klar, dass alles, was sich in die Höhe erstreckt für uns zunehmend unerreichbar ist. Der Himmel ist daher der Raum des Visuellen, die Erde der Bereich des direkt haptisch Erfahrbaren. Die Vertikale in der Architektur wird sich also zumeist nur visuell erleben lassen, die Horizontale ist dagegen der Raum unserer alltäglichen Handlungen, der Raum unserer Bewegung. Unsere Umwelt setzt sich aus Massiven Elementen und aus der sich zwischen diesen Elementen ergebenden Offenheit zusammen. Arnheim zeigt überzeugend, dass sich die Gestalt der Massive in ihrer Wirkung ganz anders verhält als die Wirkung der Gestalt der Hohlräume. Mit diesem Spannungsverhältnis beschreibt er einen der wesentlichen Gegensätze in der Architekturgestaltung. Weiter sind Bauten das beste Beispiel für Husserls Problem der Abschattung. Sie sind Dinge, die sich in Ihrer Ganzheit niemals auf einen Schlag voll erfahren lassen. Was wir sehen ist immer nur ein Teil des Ganzen, das sich uns erst in der Bewegung nach und nach voll erschließt. Diesem phänomenalen Zusammenhang geht Arnheim in Kapitel 4 „As it looks and as it is“ in verschiedenen Richtungen nach. Das führt ihn konsequent zum Thema der Bewegtheit – Kapitel 5 „Mobility“. Die meisten Bauten zeichnen sich durch Dauerhaftigkeit aus. Damit steht Architektur in der Regel gegen die Zeit. Temporalität kommt erst durch den Benutzer ins Spiel. In dessen Bewegungen entfalten sich das Formenspiel der Architektur. Wir durchlaufen Sequenzen, werden geführt und gelenkt, angezogen und abgewiesen, steigen hinauf oder hinab, werden mit Hindernissen und Schranken konfrontiert und so fort. Die individuelle Bewegung ist Teil des Aufführungsgeschehens der Architektur. In Kapitel 6 widmet sich Arnheim dem Thema der Ordnung in der Architektur aus dem Blickwinkel der Gestaltpsychologie. Diese beschreibt Gestalten als Verhältnisse von Teilen zu einem Ganzen. Die Melodie eines Musikstücks ist mehr als die Aneinanderreihung verschiedener Töne, sie ist die Gestalt der Klangfolge. Gleiches gilt für die Teile, aus denen sich ein Bauwerk zu einem Ganzen fügt und in seinen verschiedenen „Sequenzen“ erlebt wird. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, es gehört dazu das „Wie“ seiner Fügung und das Gleichgewicht der Kräfte seiner Komposition. Arnheim gelingt es das sowohl an modernen als auch an klassischen Beispielen nachzuweisen. Kapitel 7 widmet sich unter anderem der intrinsischen Dynamik von Proportionen. Betonung liegt dabei auf „Dynamik“. Es geht Arnheim weniger um die Entwicklung einer Harmonielehre, als vielmehr darum Proportionen als dynamisches – sprich auf uns einwirkendes –Gleichgewicht zu beschreiben: „Equilibrium is the counterbalancing of forces; it has no application to mere quantity.“ (Seite 221) Besonderes Augenmerk liegt hier unter anderem auf dem optischen Gewicht der verschiedenen Teile eines Gebäudes. Im letzten Kapitel untersucht Arnheim das Verhältnis von ästhetischer Wirkung (Expression) und Funktion. Arnheim vertritt hier den Standpunkt, dass es vor der ästhetischen Wirkung der Architektur kein Entrinnen gibt. Die gestalterische Berücksichtigung dieser Wirkungen ist daher kein beliebiges „Ad-on“ sondern architektonische Notwendigkeit. Arnheim plädiert daher dafür den Begriff der Funktion auf die ästhetische Wirkung der Architektur auszuweiten.
Aus meiner Sicht stellt “The Dynamics of architectural Form” einen der bedeutendsten Beiträge zur Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts dar. Es ist eine Umfassende Darstellung der Wirkung architektonischer Formen auf unsere Befindlichkeit. Ein Bereich, der in unserer rationalisierten und digitalisierten Welt, vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit erfährt, die er verdient. “The Dynamics of architectural Form” kann man auch vierzig Jahre nach seinem Erscheinen mit großem Gewinn lesen.




