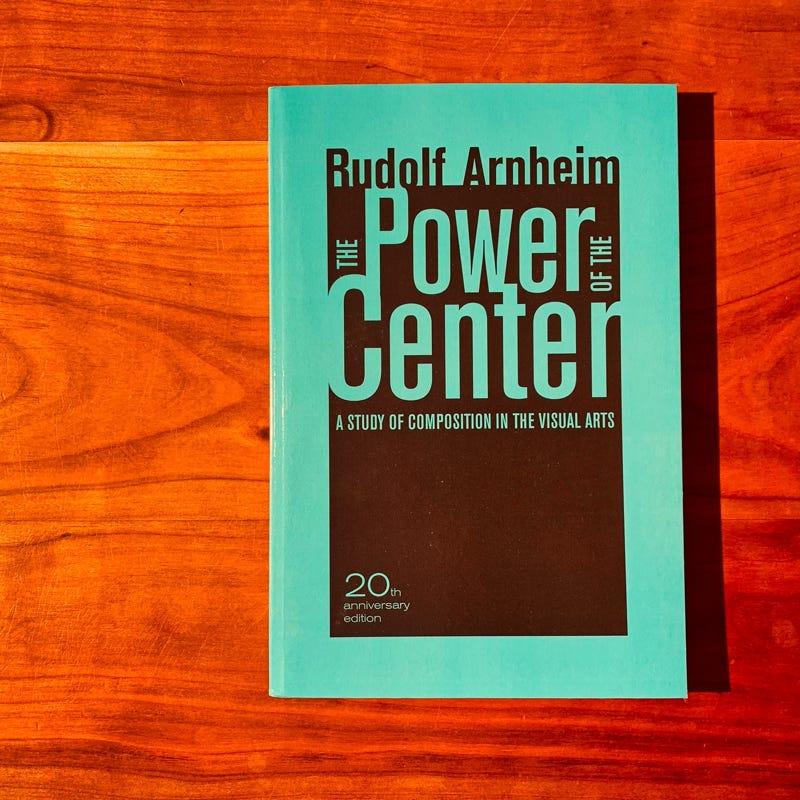
Arnheims These: Alle Gestaltungen der Bildenden Kunst (Visual Arts) – also Malerei, Grafik, Bildhauerei und Architektur – weisen zentrale und dezentrale Ordnungen auf. Dieses grundlegende Faktum sieht er in der in der unabdingbaren Verfassung des menschlichen Daseins begründet. Die zentrische Tendenz liegt in unserer psychologischen Konstitution, in der wir selbst das Zentrum all unserer Perspektiven, Motivationen und Intentionen bilden. „The infant sees himself as the center of the world surrounding him.“ (Seite 2) Demgegenüber steht die Welt, die ihrerseits voll ist von in sich selbst ruhenden Zentren und die daher im Ganzen – aus der Sicht des Einzelnen - als exzentrische Ordnung beschrieben werden kann. Die ursprünglichste Erfahrung dieser Ordnung ist die Kraft der Gravitation, die permanent exzentrisch auf uns wirkt und der wir mit unserer eigenen Körperkraft permanent entgegenwirken, sofern wir uns von der Erde aufrichten. Arnheim begreift daher Zentrum und Exzentrizität als zwei zusammengehörige Pole eines grundsätzlich bestehenden Spannungsverhältnisses, in das wir selbst eingebunden sind. Dieses Spannungsverhältnis spiegelt sich notwendig in der Bildenden Kunst wider.
Das Wort „Zentrum“ kann nach Arnheim in mehrfacher Hinsicht gebaucht werden. Einmal bezeichnet es ein Kraftzentrum, das sich in seine Umgebung verstrahlt. Dann wiederum das Zentrum verschiedener Kräfte, die „konzentrisch“ aufeinander zulaufen. Im Gegensatz zu diesen beiden Formen meint Zentrum aber auch schlicht die Mitte „zwischen“ verschiedenen anderen Dingen. Diese Mitte kann letztlich auch leer bleiben. Man könnte in der Folge von „erfüllten“ und von „unerfüllten“ Zentren sprechen. Allein aus den genannten Gegensätzen ergibt sich ein reichhaltiges Spannungsfeld gestalterischer Möglichkeiten. Stimmt man Arnheims These zu, dass wir selbst ein ursprüngliches Zentrum darstellen, dann ist es nachvollziehbar, die eigene Zentriertheit in der Auseinandersetzung mit der Kunst als ein weiteres ihrer Momente – sozusagen als Teil des Aufführungsgeschehens – zu fassen. Bildende Kunst hat etwas mit unserer Orientierung im Raum zu tun. Gerade für unser Verständnis der Architektur ist das ein wesentlicher Gesichtspunkt. Folgt man Arnheim weiter, so gibt es zwei grundsätzliche Arten den scheinbar unendlichen Raum zu organisieren: 1. Die Etablierung von Landmarken, Knotenpunkte um die herum sich untergeordnete Stellen im Raum organisieren. 2. Das Setzen von „Rahmen“, das heißt die Ziehung von Grenzen im Raum. Aus diesem Gegensatz von in Orten konzentrierten Räumlichen Bezügen und aus einem Offenen heraus abgegrenzten Freiräumen ergibt sich ein weiteres Spannungsmoment bildnerischer Gestaltung. Mit der Grenze stellt sich die Frage nach der Gestalt dieser Grenze. Für die Malerei untersucht Arnheim diese Frage im Kapitel „Tondo and Square“, womit der Gegensatz von eckigen und runden Formen ins Spiel kommt. Die Form des Bildes ist eine eigene gestalterische Kraft, wie schon Kandinsky in seiner Schrift „Punkt und Linie zu Fläche“ ausführlich darlegt. Zentren sind unter anderem Knoten, an denen verschiedene Bewegungen oder Kräfte zusammenlaufen und sich so bündeln. Dem Zentrum wohnt ein Moment der Vereinigung inne. Demgegenüber analysiert Arnheim gerade für die Malerei das Phänomen der Kluft, die sich zwischen verschiedenen Teilen des Bildes aufzutun vermag. Damit spricht er Zentren ebenso als trennendes Moment an. Wiederum hauptsächlich in der Malerei ergibt sich zentrische Organisation aus der Entwicklung der Perspektive und deren Überwindung in der Moderne. Der Sog in die Tiefe des Raums entsteht allein durch die Organisation der Dinge zueinander und entfaltet eine eigene Dynamik, deren Zentrum – der Fluchtpunkt – möglicherweise ebenfalls leer bleibt.
Für die Architektur zeigt sich eine fundamentale Differenz in der Organisation der Vertikalen zur Horizontalen. Sie stemmt sich, wie wir selbst, gegen die Gravitation und ist damit ihrer exzentrischen Organisation unterworfen. Diese Organisation sich an der Erdoberfläche in zwei grundsätzlich unterschiedliche Bereiche: das Haptische (die undurchdringliche Erde) und das Optische (offener Horizont, Himmel). In der Horizontalen bildet das Bauwerk eine Grenze unseres nach allen Seiten sich gleichmäßig erstreckenden Handlungsraums. Gebäude stellen dabei eine Folge, oder – wie Arnheim richtig analysiert – eine Sequenz von Räumen in unterschiedlichen Konstellationen des Verhältnisses Begrenzung und Raum. Daraus ergibt sich in der Bewegung durch Raumfolgen ein musikalisches Moment, dass die ganz eigene Zeitlichkeit der „Aufführung“ des architektonischen Werkes ausmacht. Der Permanenz des architektonischen Werkes steht die Selbsterfahrung seiner Bewohner in der Bewegung gegenüber – eine Überlagerung verschiedener zentrischer und exzentrischer Systeme in der Zeit. Diese räumlichen Verhältnisse einer Komposition lassen sich abstrakt beschreiben und Darstellen. Darin liegt der theoretische Erkenntnisgewinn:
„The relation between the complexity of the fully realized work and the most abstract visual formula of its essence reveals the full range of its meaning. To this revelation the study of composition is dedicated.” (Seite 224)
„The Power of the Center” ist 30 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch ein Standardwerk der Theorie der Gestaltung. Das liegt daran, dass es Arnheim gelingt in einem interdisziplinären Ansatz die großen Themen der Gestaltung aus verschiedenen Perspektiven anschaulich darzustellen.




