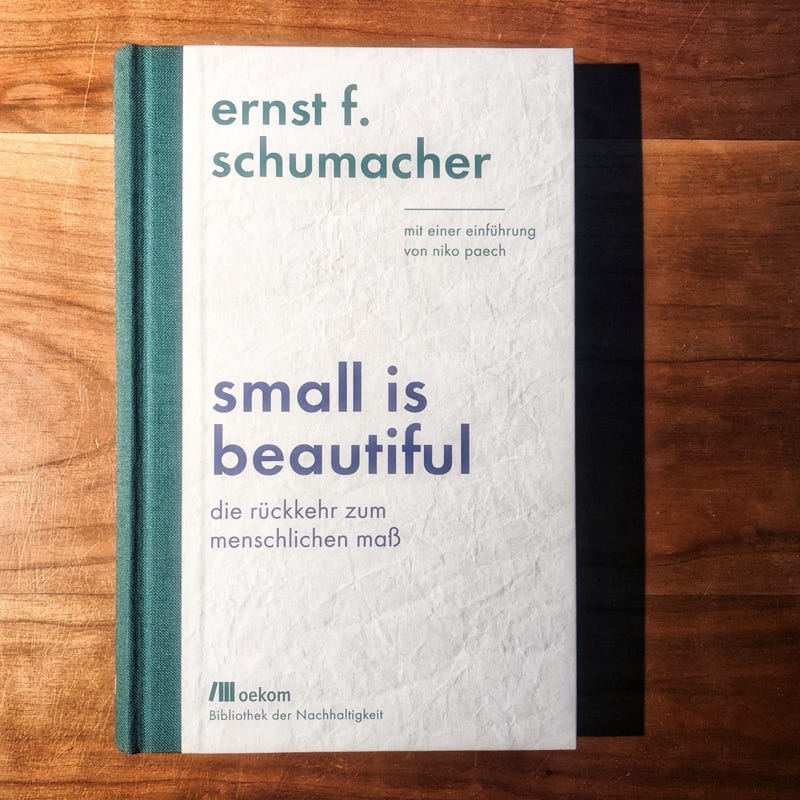
Das Werk gliedert sich in vier Teile: 1. Die moderne Welt; 2. Aktivposten; 3. Die dritte Welt; 4. Organisation und Eigentum. Teil 1 liefert eine Beschreibung des Problems, den Status quo der 70er-Jahre, wenn man so will. Der Zweite Teil mustert die Mittel, die – aus Schumachers Sicht – die Weltgemeinschaft zur Lösung des globalen Problems in Händen hält. Teil 3 beschäftigt sich mit der Lösung des Problems in der nicht-westlichen Welt. Darin liegt offensichtlich eine Unterlassung, die der vierte Teil im Rahmen einer Kapitalismuskritik und über das Modell eines alternativen Kapitalismus zu reparieren versucht. Es ist heute offensichtlich, dass das westliche Weltbild und das daraus resultierende westliche Handeln der Ursprung und die Ursache der Katastrophe sind. Ich gebe hier Schumachers Gedankengang wieder, wie ich ihn verstehe.
1. Analyse des Problems – Die moderne Welt
Ernst F. Schumacher ist ein Ökonom. Das finde ich besonders bemerkenswert. Er ist also kein genuiner „Öko“. Weder ist er Politiker noch Naturwissenschaftler, weder Soziologe noch Philosoph, oder einer von denen, die sonst immer gerne die Welt erklären. Nein – der Mann ist Wirtschaftswissenschaftler. Wenn er also im Jahre des Herrn 1973 von der herannahenden ökologischen Katastrophe berichtet, dann tut er dies aus ökonomischer Sicht, das heißt aus der Perspektive haushälterischer Gesetzmäßigkeiten. Óikos ist der Haushalt und die nomoi sind die dazugehörigen Setzungen oder Gesetze. Mit Schumacher kann man die globalisierte Welt als einen Haushalt verstehen, für den diese grundsätzlichen haushälterischen Gesetzmäßigkeiten gelten. Das ist zuallererst die klare Unterscheidung von Kapital und Ertrag:
„Und dieses [die Täuschung über die Lösung des Problems der Produktion] gründet auf der Unfähigkeit, da zwischen Ertrag und Kapital zu unterscheiden, wo es auf diese Unterscheidung am meisten ankommt. Jeder Betriebswirtschaftler und Geschäftsmann kennt den Unterschied und wendet ihn bewusst und mit beträchtlichem Scharfsinn auf alles wirtschaftliche Tun an – außer da, wo es wirklich wichtig wäre: beim unersetzlichen Kapital, das der Mensch nicht selbst geschaffen, sondern einfach vorgefunden hat. Ein Geschäftsmann würde von einer Firma nicht annehmen, dass sie ihre Probleme der Produktion gelöst hat und lebensfähig ist, wenn er sähe, dass sie rasch ihr Kapital aufbraucht.“ (Seite 26)
Die Erkenntnis endlicher Ressourcen ist die Erkenntnis, dass wir global betrachtet unser gegebenes Kapital aufbrauchen. Die Ausbeutung der natürlichen, nichtregenerativen Ressourcen behandelt diese als „Ertragsposten […] obwohl sie unzweifelhaft zum Kapital gehören.“ Schumacher verdeutlicht das am Beispiel fossiler Brennstoffe, deren Endlichkeit heutzutage auch dem letzten klar sein sollte. Der ökonomische Grundsatz gilt aber genauso für jeden anderen irdischen Stoff, der sich nicht regeneriert, insbesondere auch für radioaktives Material. In extenso gilt er auch für alles organische Leben, das einmal ausgestorben nicht wieder zum Leben erweckt werden kann. Wir sind also, global betrachtet, wie eine Firma, die ihr Kapital aufbraucht und früher oder später Pleite gehen wird.
Wirtschaftswissenschaftlich gesehen stößt damit die Theorie des „Unbegrenzten Wachstums“ an die realen Grenzen der natürlich gegebenen Ressourcen. In einem abgeschlossenen System – ein solches bildet, cum grano salis, der Globus – kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. „Eine Haltung dem Leben gegenüber, die ausschließlich im Streben nach Reichtum Erfüllung sucht – kurz gesagt im Materialismus, passt nicht in diese Welt, weil sie kein begrenzendes Prinzip anerkennt.“ (Seite 41) Diesen Umstand kann, logisch betrachtet, auch ein Mehr an Technik nicht beseitigen. Auch ein effizienter Verbrauch von Ressourcen verbraucht eben Ressourcen. Es zeigt sich: unbegrenztes Wachstum auf der Basis der Ausbeute endlicher Ressourcen ist logisch nicht denkbar.
Schumacher teilt zur Verdeutlichung dieser These den Begriff „Güter“ dihairetisch in vier Gruppen. Güter allgemein lassen sich zunächst in zwei Gruppen unterteilen: naturgegebene Güter oder solche, die von Menschenhand geschaffen sind. Diese beiden Gruppen lassen sich ihrerseits in zwei Untergruppen unterteilen: Naturgegebene Güter sind entweder erneuerbar oder nicht erneuerbar. Von Menschenhand geschaffene Güter sind Erzeugnisse oder Dienstleistungen. Dabei ist entscheidend, dass alle von Menschenhand erschaffene Erzeugnisse auf der Umwandlung naturgegebener Güter basieren:
„Immerhin ist der Mensch kein Erzeuger, sondern lediglich ein Umwandler, für jede Umwandlungstätigkeit braucht er Grundstoffe. Insbesondere hängt seine Fähigkeit zur Umwandlung von primärer Energie ab, was sofort auf die Notwendigkeit einer überaus wichtigen Unterscheidung auf dem Gebiet der Grundstoffe verweist, nämlich jener zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren.“ (Seite 61f)
Damit ist klar, dass Erzeugnisse nur dann nachhaltig sein können, wenn sowohl ihre Grundstoffe regenerativ sind als auch der Prozess ihrer Erzeugung nur auf regenerative Ressourcen zurückgreift. Alle anderen Erzeugnisse, Dienstleistungen oder damit verbundene Prozesse greifen das naturgegebene „Kapital“ an und sind damit in einem höheren Sinne des Globalen Gesamthaushaltes „unwirtschaftlich“. Schumacher selbst nennt diese Zusammenhänge selbst „Meta-Wirtschaftswissenschaftlich“ – nur auf ihrer Basis kann eine eigentliche „wirtschaftswissenschaftliche Analyse beginnen […]“ (Seite 62f)
„Noch wichtiger ist die Erkenntnis des Vorhandenseins von >Gütern<, die niemals auf dem Markt erscheinen, weil sie nicht privat angeeignet worden sind oder weil es nicht möglich ist, die aber dennoch wesentliche Vorbedingungen allen Menschlichen Tuns sind, wie zum Beispiel Luft, Wasser, Boden und überhaupt der gesamte Rahmen der lebenden Natur.“ (Seite 63)
Diese gegebenen Grundlagen, die gleichzeitig den Rahmen allen wirtschaftlichen Handelns bilden, wurden – beziehungsweise werden – von der Wirtschaft und ihrer zugehörigen Wissenschaft als gegeben gesetzt. Was niemandem „gehört“ darum muss sich auch keiner kümmern. Die Unterschlagung des allgemeinen, allen gehörenden „Kapitals“ in den Gleichungen wirtschaftlicher Betrachtungen ist damit die Ur-Sünde des Kapitalismus.
Auf der Verkennung der ökonomischen Grundvoraussetzungen unseres Wirtschaftssystems baut ein weiterer, nicht minder schwerer Irrtum auf: Der Lebensstandard einer Gesellschaft wird an ihrem Verbrauch, beziehungsweise an ihrem Konsum gemessen. Das Wohlbefinden einer Gesellschaft wird mit Konsum von Gütern gleichgesetzt. „Güter [werden] für wichtiger als Menschen und Konsum für wichtiger als schöpferisches Tun gehalten […] Damit wird der Schwerpunkt vom Arbeiter auf das Ergebnis der Arbeit verlagert, das heißt vom Menschlichen zum Untermenschlichen.“ (Seite 68) Aus der kapitalistischen Sicht ist Arbeit ein notwendiges Übel. Daher ist jedes Mittel recht, um sie zu vermeiden oder zumindest zu automatisieren. Dabei könnte man genauso gut behaupten, ein System, das weniger verbraucht und dabei dasselbe Wohlbefinden erreicht, ist im Grunde das wirtschaftlichere System. Schumacher vergleicht daher die moderne westliche Wirtschaftsweise mit einer mehr oder weniger fiktiven buddhistischen Wirtschaftstheorie.
Hier liegt der Fall etwas anders. Arbeit erfüllt dort drei Aufgaben: „Sie gibt dem Menschen die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu nutzen und zu entwickeln. Sie hilft ihm, aus seiner Ichbezogenheit herauszutreten, indem sie ihn mit anderen Menschen in einer gemeinsamen Aufgabe verbindet, und sie erzeugt Güter und Dienstleistungen, die für ein menschenwürdiges Dasein erforderlich sind.“ (Seite 66) Arbeit ist nicht nur ein Mittel zum Konsum, sondern als Sinn stiftende Tätigkeit selbst Zweck in sich. „Die buddhistische Wirtschaftsweise versucht kurz gesagt, ein Höchstmaß an menschlicher Zufriedenheit durch das günstigste Verbrauchsmuster [an Ressourcen]zu erzielen, während die moderne versucht, den Verbrauch mithilfe des günstigsten Musters von Produktionsanstrengungen auf ein Höchstmaß zu schrauben.“ (Seite 69) Das eine System fordert das größtmögliche Wachstum, das andere hat den kleinstmöglichen Fußabdruck.
2. Mögliche Mittel zur Lösung des Problems – Aktivposten
Nach der Analyse des grundsätzlichen Problems im westlichen Wirtschaftsdenken, widmet sich Schumacher einer Reihe von Institutionen, deren Veränderung zur Lösung der Probleme beitragen könnten. Er nennt sie Aktivposten. Der erste Aktivposten, den Schumacher diskutiert, ist die Bildung. Sie ist „die wichtigste Quelle menschlichen Daseins.“ (Seite 87) Alle menschliche Entwicklung, unser ganzes Überleben hat etwas mit Bildung zu tun. Wobei Schumacher betont Bildung von Wissenschaft unterscheidet. Letztere beschäftigt sich mit den Fakten und Zusammenhängen ihrer jeweiligen Disziplinen. Die Bildung dagegen spannt den Rahmen des großen Ganzen auf und erlaubt es einzelne Erkenntnisse darin einzuordnen. Die Bildung in Schumachers Verständnis erfasst die Ziele und nicht allein die Machbarkeit der Mittel.
„Wir wissen von vielen Dingen, wie man sie tut, aber wissen wir, was wir tun sollen? Ortega y Gasset sagte es knapp und deutlich: >Wir können auf der menschlichen Ebene nicht ohne Vorstellungen leben. Von ihnen hängt ab, was wir tun. Leben bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass man eine Sache an Stelle einer anderen tut.<“ (Seite 94)
Leben bedeutet Entscheidungen zu treffen. Wonach richten sich diese Entscheidungen? Sie richten sich nach bestimmten allgemeinen Vorstellungen, die wir uns von der Welt und unserer Rolle darin machen. Vorstellungen, in denen wir uns in gewisser Weise immer schon bewegen. Es ist das Wesen der Naturwissenschaft und in extenso der Technik, dass sie gerade keine solchen Vorstellungen hervorbringen, sondern sich selbst im Rahmen von „Vorurteilen“ über die Welt im Ganzen bewegen. Wissenschaft und Technik betrachten sich in ihrem Wesen als faktisch wertneutral und bewegen sich dadurch selbst wiederum in den voraussetzungsreichen Vorurteilen einer Vorstellung.
Um zu verdeutlichen, was er mit dem Begriff der „Vorstellung“ meint, gibt Schumacher Beispiel vorherrschender Vorstellungen des 20. Jahrhunderts. Da ist die Vorstellung der Evolution, der Gedanke, dass sich alles permanent aussondert und entwickelt. Daraus vielleicht abgeleitet die Vorstellung des Kampfes ums Dasein. Wohlmöglich gehört hierher auch die Vorstellung eines Kampfes der Kulturen. Seit Marx gibt es eine Sichtweise, die „alle edlen Erscheinungsformen des Menschlichen Lebens, wie Religion, Philosophie, Kunst und so weiter […]“ skeptisch als „>Ergänzungen zum materiellen Lebensprozess<“ darstellt. Mit Freud gibt es dazu eine Gegenbewegung, die eben diese Erscheinungsformen auf ein inzestgebeuteltes Unterbewusstsein zurückführt. Weiter bahnbrechend die Vorstellung der Relativität. Last but not least: „die siegreiche Vorstellung des Positivismus, dass gültiges Wissen nur durch die Methodik der Naturwissenschaften zu erlangen ist und dass mithin kein Wissen allgemeingültig ist, wenn es nicht auf beobachtbaren Tatsachen beruht.“ Letzteres ist das „Vorurteil“ der Wissenschaft selbst, das wissenschaftliche Weltbild. Dazu Schumacher lapidar:
„Relativismus und Positivismus sind selbstverständlich rein metaphysische Lehren, die sich in ironischer Weise besonders dadurch auszeichnen, dass sie die Gültigkeit alle Metaphysik einschließlich ihrer selbst leugnen.“ (Seite 98)
Schumachers Gedankengang ist einfach nachzuvollziehen: Wenn uns also unsere fragwürdigen westlichen Vorstellungen und „Vorurteile“ an den Punkt gebracht haben, an dem wir heute sind und wenn nur Bildung dazu befähigt sich über die eigenen Vorstellungen, Vorurteile und Voraussetzungen Rechenschaft abzulegen, dann ist Bildung mindestens ein Weg, unsere Sicht auf die Welt und unsere Rolle in ihr zu verändern. In diesem Sinne ist Bildung für Schumacher ein Aktivposten.
Ein weiterer Aktivposten ergibt sich aus unserem direkten Umgang mit der Natur, da wo sie unsere Existenz substantiell betrifft: beim Anbau von Lebensmitteln. „Es erhebt sich die Frage, ob Landwirtschaft tatsächlich eine Industrie ist oder ob sie etwas wesentlich anderes darstellt. Es überrascht nicht, dass diese Frage, eine metaphysische – oder meta-wissenschaftliche – Frage, von Wirtschaftswissenschaftlern nie gestellt wird.“ (Seite 119) Die Antwort liegt für Schumacher auf der Hand: Die Landwirtschaft arbeitet mit lebendiger Natur, das „Ideal der Industrie besteht in der Ausschaltung des lebendigen, und das heißt auch des menschlichen Faktors […]“ (Seite 119) Ein Umdenken in der Landwirtschaft tut daher offensichtlich Not. Das hat drei wesentliche Konsequenzen für die Landwirtschaft:
„Sie soll die Verbindung des Menschen mit der lebenden Natur, deren leicht verwundbarer Teil er ist und bleibt, aufrechterhalten; sie soll die weitere Umwelt des Menschen menschenwürdig gestalten und veredeln und sie soll Nahrungsmittel und sonstige Materialien produzieren, die für ein angemessenes Leben erforderlich sind.“ (Seite 122)
Das dies auch heute weltweit gesehen immer weniger der Fall ist, kann glaube ich jeder sehen. Der nächste Aktivposten, über den wir verfügen, sind die klassischen Rohstoffe, vom Sand bis zu den sogenannten „seltenen Erden“. Keiner dieser Rohstoffe ist unendlich verfügbar. Unendliches Wachstum würde ein unendliches Rohstoffvorkommen voraussetzen. Es sei denn man versteht unter Wachstum die Preissteigerung an den Rohstoffmärkten. Diese steigen bei zunehmender Verknappung allerdings ins unendliche, was global-gesellschaftlich bestimmte Konsequenzen mit sich bringt. Hier zeigt sich auf einem einzelnen Sektor, was zuvor schon für das große Ganze diagnostiziert wurde: Eine Verschwendung von Ressourcen ist eine Verschwendung von Kapital. Ressourcen sind demnach ein Aktivposten von unschätzbarem Wert.
Schließlich diskutiert Schumacher die Atomkraft als mögliche Lösung der Energiekrise. Er tut dies vor dem Hintergrund eines ökologischen Grundsatzes, den er bei Ralf und Mildred Buchsbaum entlehnt:
„>dass einer über Millionen Jahre hin gewachsenen Umwelt eine gewisse Daseinsberechtigung zugebilligt werden muss. Etwas, das so kompliziert ist wie ein Planet, der von über eineinhalb Millionen Arten Pflanzen und Tieren bewohnt wird, die alle in einem mehr oder weniger ausgewogenen Gleichgewicht zusammenleben, indem sie fortlaufend dieselben Luft- und Bodenmoleküle verwenden und wiederverwenden, lässt sich durch planloses und unwissendes Herumpfuschen nicht verbessern. Alle Veränderungen an einem komplexen Mechanismus bringen Gefahren und dürften nur nach sorgfältiger Prüfung aller verfügbaren Tatsachen vorgenommen werden. Veränderungen müssten zuerst im kleinen Maßstab durchgeführt werden, sodass vor ihrer allgemeinen Einführung eine Prüfung erfolgen kann. Wenn das Wissen in einem Zusammenhang unzureichend ist, müssten sich Veränderungen eng an die natürlichen Vorgänge anlehnen, für die der unwiderlegliche Beweis spricht, dass sie das Leben über einen sehr langen Zeitraum erhalten haben.>“ (Seite 143)
Wenn dieser Grundsatz Gültigkeit hat, und man wird es schwer haben das zu bestreiten, dann kann man der Kernenergie – egal ob Spaltung oder Fusion – nicht mehr das Wort reden. Wir haben seither Tschernobyl und Fukushima erlebt. Die Atomkraft ist am Ende. Ex negativo kommen als Aktiva daher nur noch regenerative Energien in Frage.
Schumachers letzter Punkt in diesem Kapitel widmet sich keinem weiteren Aktivposten, sondern der Art und Weise ihres Einsatzes. Er spricht von einer „Technologie mit menschlichen Zügen.“ Alle natürlichen Prozesse haben die Grenzen ihres Wachstums in sich selbst. Diese immanente Selbstbegrenzung fehlt der Technik. Gegen diese Tendenz der Technik setzt Schumacher auf Dezentralisierung und das, was er „mittlere Technologie“ nennt. „Man kann sie auch Selbsthilfe-Technologie oder demokratische oder Volkstechnologie nennen – eine Technologie jedenfalls, zu der jedermann Zutritt hat und die nicht denen vorbehalten ist, die bereits reich und mächtig sind.“ (Seite 162) Damit sind arbeitsintensivere Low-Tech-Prozesse gemeint, die überall auf der Welt ohne die Voraussetzung größerer Infrastruktur angewandt werden können. Damit propagiert Schumacher gleichzeitig einen freiwilligen Verzicht auf Technik deren lokale Konzentration. Er wendet sich gegen die Flucht nach vorn in immer neue, heilsversprechende technische Entwicklungen, die die Sünden der Vergangenheit und die Probleme der Gegenwart mit zukünftigen großartigen Projekten verschwinden lassen sollen.
3. Umsetzung in der nicht-westlichen Welt – Die dritte Welt
Gerade der letzte Punkt bei den Aktivposten, zielt natürlich auf die sogenannte „Dritte Welt“. Der Versuch diese durch verschiedenste Großprojekte auf den industriellen Stand der westlichen Welt zu bringen ist aus verschiedensten Gründen gescheitert. Daher sind dezentralisierte Low-Tech-Projekte aus der Sicht der 70er-Jahre das Mittel der Wahl. Schumachers Vorschlag für die Entwicklung von Arbeitsplätzen in der nicht-westlichen Welt sieht folgendermaßen aus:
„Erstens müssen Arbeitsplätze in den Gebieten geschaffen werden, wo die Menschen jetzt leben, und nicht in erster Linie in Großstadtbereichen, wohin sie sonst wandern würden. Zweitens müssen Arbeitsplätze im Durchschnitt billig genug einzurichten sein, sodass eine große Zahl davon zur Verfügung gestellt werden kann, ohne dass Kapitaleinsatz und unerschwingliche Einfuhren von Maschinen erforderlich sind. Drittens müssen die angewandten Produktionsverfahren relativ einfach sein, sodass nur ein Mindestmaß an Facharbeit erforderlich ist. Das gilt nicht nur für den eigentlichen Produktionsprozess, sondern auch für die Organisation, die Rohmaterialbeschaffung, die Finanzierung, den Vertrieb und so weiter. Viertens muss hauptsächlich aus einheimischen Materialien und hauptsächlich zum Verbrauch am Ort produziert werden.“ (Seite 179)
Hier wird deutlich, dass dieser Text vor der digitalen Revolution geschrieben wurde. Heute sind sicher auch hoch vernetzte hybride Lösungen regionaler Entwicklung denkbar – Low-Tech meets Digitalization. Die mobile Kommunikation kennt die Trennung in westliche Welt und „Dritte Welt“ nicht mehr. Ähnliches gilt für den Zugang zum Internet. Abhängig ist beides eigentlich nur von der zureichenden Elektrifizierung. Bedenkt man, dass die meisten Länder, die wir heute als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnen in eher sonnenreicheren Regionen liegen, ist das lediglich ein Problem flächendeckender Versorgung mit Solarenergie und deren Speicherung. Post-Corona gewinnt die Forderung nach Dezentralisierung und Lokalisierung der Produktionsprozesse einschließlich Lieferketten ein neues Gewicht. Nachhaltige Systeme sind nun einmal dezentral und redundant aufgebaut. Das gilt für die globale Wirtschaft ebenso wie für das lokale Netzwerk.
Ansonsten wirken Schumachers Vorschläge etwas postkolonialistisch und sind im 21. Jahrhundert sicher an vielen Stellen durch die Realität eingeholt und überholt worden.
4. Wie steht es mit der westlichen Welt? – Organisation und Eigentum
Das letzte Kapitel enthält einige sehr interessante Überlegungen zum Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit, zum Unterschied von Tat und Ereignis und zur Unterscheidung zwischen Vorhersage und Planung.
„Doch die Tatsache bleibt, dass eine Maschine zum Voraussagen der Zukunft metaphysische Annahmen einer sehr bestimmten Art verarbeitet. Sie beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung, dass >die Zukunft bereits da ist<, dass sie bereits in einer festgelegten Form existiert, sodass lediglich gute Instrumente und gute Technologien nötig sind, um sie in den Blick zu bekommen und erkennbar zu machen.“ (Seite 223)
Das ist die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit, also demjenigen was eine bestimmte Wirkung ausübt, das, was mit Kausalitäten zu fassen ist und dem, was (zukünftige) Möglichkeiten in sich birgt, also den Spielräumen, die diese Wirklichkeiten lassen, etwa für Entscheidungen und Handlungen. „Die wichtigste Unterscheidung ist im Allgemeinen die zwischen Taten und Ereignissen.“ (Seite 225) Ereignisse sind dabei Geschehnisse, die nicht in der Hand des einzelnen liegen, Umweltkatastrophen oder Revolutionen beispielsweise. Taten sind alle Handlungen, die ein einzelner oder eine Gruppe gemeinsam ausführen. Es ist klar, dass nur Handlungen konstitutiver Teil einer Planung sein können. Pläne können allenfalls Raum für bestimmte Ereignisse lassen, die man erwartet. Ereignisse bleiben also auf eine gewisse Weise ungreifbar, insbesondere Dort, wo es sich um Ereignisse handelt, die von der Psychologie der Massen abhängig sind.
„Die Zukunft ist stets im Entstehen begriffen, aber sie entsteht weitgehend aus vorhandenem Material, über das man viel wissen kann. Daher ist die Zukunft weitgehend voraussagbar, wenn wir festes und umfangreiches Wissen von der Vergangenheit haben. Weitgehend, aber keinesfalls vollständig. Denn in das Entstehen der Zukunft geht jener geheimnisvolle und unbesiegbare Faktor ein, den wir die Freiheit des Menschen nennen.“ (Seite 227)
Überall dort, wo die Freiheit des Menschen betroffen ist, stößt die Planung an Grenzen. Nur im Bereich der Technik gibt es theoretisch auch vollständige Vorhersehbarkeit. Die Grenze des Planbaren ist also die Freiheit. Planung ist demnach eine Absichtserklärung der “Planer – oder ihrer Auftraggeber“, sie ist „untrennbar von [deren] Macht“ zur Umsetzung.
Schumachers Überlegungen führen ihn auf Umwegen über eine kurze Betrachtung des Sozialismus schließlich zur Frage nach dem Eigentum, das schon Jean-Jaques Rousseau als Quelle für die Ungleichheit unter den Menschen ausgemacht hat. Die Frage des Eigentums ist in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Privatisierbarkeit der Natur. Weiter kann man sich mit Schumacher die Fragen stellen, ob Eigentum die Grundlage produktiver Handlungen ist oder deren Ersatz. Ist also das Eigentum die Grundlage dafür, etwas aufzubauen, dass einigen oder sogar vielen nützlich ist oder ist es lediglich die Grundlage dafür, dass ein einzelner nichts mehr leisten muss? Was wird aus einer Gesellschaft, in der Besitz an Gütern das höchste Gut darstellt und die gleichzeitig allen – je nach Leistung, was immer man darunter versteht – diese Güter verspricht?
„Ist es vorstellbar, dass ein solches System mit den Aufgaben fertig wird, denen wir uns jetzt gegenübersehen? Die Antwort ergibt sich von selbst: Habsucht und Neid verlangen fortgesetztes und grenzenloses Wirtschaftswachstum materieller Art, ohne dass etwas für die Bewahrung getan wird. Diese Art von Wachstum kann unmöglich in eine begrenzte Umwelt passen.“ (Seite 261)
Wie Schumachers Beispiel der Scott Bader & Co. Ltd. Zeigt, predigt er keineswegs die Verstaatlichung von Unternehmen oder auch nur eine wie auch immer geartete staatliche Regulierung. Schumacher setz vielmehr – etwas naiv vielleicht – auf die Eigeninitiative der Wirtschaft, auf einen Mittelstand, der erkennt, dass die aktuelle Art und Weise zu wirtschaften zukünftigen Generationen nichts anderes hinterlassen wird als einen abgebrannten Planeten. Ein frommer Wunsch – mag sein.
Jedoch, die Analyse des Problems hat Bestand. Das unendliche Wirtschaftswachstum ist ein gefährlicher Mythos. Verzicht tut Not. Alternative Modelle zur Industrieproduktion und zur Machtkonzentration global agierender Konzerne müssen entwickelt werden. Technische, insbesondere gen- und biotechnische Entwicklungen dürfen – und müssen – vor dem Hintergrund der Komplexität unseres natürlichen Lebensraumes kritisch hinterfragt werden. Ein nachhaltiger Low-Tech Ansatz könnte hier Lösungen bieten. Dezentrale Strukturen, die Entwicklungen in die Fläche tragen, anstatt sie an einem Standort zu konzentrieren sind das Gebot der Zeit. Hybride Lösungen sind möglich. Vernetzte Systeme mit den nötigen Redundanzen bergen sehr viel geringere Risiken im Falle von Störungen oder im Vorfeld nicht bedachter Probleme. Sie ermöglichen eine Beteiligung der Vielen und erscheinen daher einerseits demokratischer andererseits aber auch regional anpassungsfähiger.
Als Architekt verstehe ich diese Analyse als Herausforderung zu einer Rückkehr der Architektur zu ihren Ursprüngen. Was ist eine nachhaltige, Low-Tech-Architektur, die nicht allein nach ökologischen, sondern eben auch nach ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Eine Architektur, jenseits von BUS und BIM. Digital angebunden meinetwegen, vernetzt und gleichzeitig autark. Modern und archaisch zugleich – preiswert, nachhaltig, ökologisch, dauerhaft. Hier schließen sich Schumachers Thesen ganz ungezwungen an die zuvor betrachteten Thesen Richard Neutras an. Es geht um eine Architektur, die sich in ihre natürliche und gebaute Umwelt zwanglos einfügt.
Die vorliegende Schrift ist fast fünfzig Jahre alt. Das möchte man nicht glauben. Wenn man sie heute liest, ist sie so aktuell, wie am Tag ihres Erscheinens. Wie ist das möglich? Hat sich in den letzten fünfzig Jahren so wenig getan? Im Grunde muss man das so konstatieren: wir leben immer noch vom Kapital und nicht von den Erträgen. Solange sich das nicht ändert, wird der Kuchen für zukünftige Generationen immer kleiner, der Schaden, der entsteht, wird zunehmend irreparabel und das Leben auf dieser Erde wird immer unerträglicher. Wohlgemerkt: Es ist nicht Schumachers Absicht den Kapitalismus abzuschaffen. Er versuch lediglich ihn von seinen falschen Voraussetzungen zu befreien.




